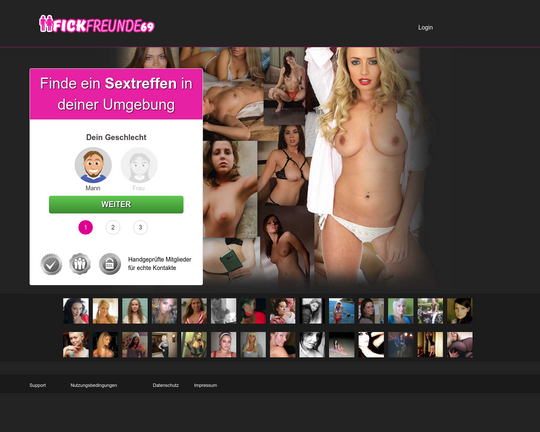Aus dem Netz für das Netz.
Autor mir nicht bekannt.
HAUS SALEM, Teil 1
Der Unterricht bei Schwester Roberta hatte bereits begonnen, als Schwester Eulalia mit der Neuen zur Tür hereinkam. Neugierig betrachteten wir das Mädchen. Es trug Jeans und T-Shirt und Turnschuhe, was es unter uns Mädchen in Anstaltskleidung seltsam unpassend aussehen ließ. In Haus Salem trugen alle Mädchen das Gleiche: Ein einfaches Sommerkleid aus grauem Stoff mit weißem Kragen, das kurz oberhalb der Knie endete. Turnschuhe trug keine. So etwas war nicht erlaubt. Winters gab es grobe schwarze Schuhe und für schlechteres Wetter Stiefel von gleicher Farbe. Im Frühjahr wechselten wir zu offenen Sandalen und sobald es warm genug war, wurden auch diese weggesperrt, was spätestens am 1.Mai geschah. Vor dem 1.Oktober sahen unsere Füße kein Schuhwerk mehr, außer wenn wir – was selten vorkam- geschlossen einen Ausflug machten, der uns in die Stadt führte. Die Schulwanderungen durch die Natur rund ums Internat absolvierten wir barfuss. Nackte Füße gehörten zur speziellen Erziehung Salems wie all das andere auch.
Die Neue hatte langes, dunkelblondes Haar und ihre graublauen Augen blitzten misstrauisch unter einem dichten Stirnpony hervor. Was sie sah, schien ihr nicht zu gefallen. Das konnte ich gut verstehen. Mir war es drei Jahre zuvor auch nicht anders ergangen, als ich als Zehnjährige nach Salem gekommen war. Die strenge, farblose Anstaltstracht hatte mich geängstigt genau wie die Kahlheit der Räume des Internats. Es gab keinen Schmuck, keine Bilder, nichts, nur kahle Wände; nicht einmal Vorhänge an den hohen Fenstern.
„Dies ist eure neue Klassenkameradin Hannah Gessner“, sprach Schwester Eulalia. „Ihre Eltern schicken sie zu uns, damit sie Gehorsam erlernt. Sagt Hannah Guten Tag, Mädchen.“
Wir erhoben uns und sagten im Chor: „Guten Tag, Hannah.“
Schwester Eulalia brachte die Neue zu dem freien Platz neben mir: „Du wirst ab jetzt neben Sigrid Schmidt sitzen, Hannah. Sie wird gleich mit dir zur Kleiderkammer gehen, damit du Anstaltskleidung empfangen kannst.“ So lief es immer. Nicht die Schwestern kleideten die Neuen ein sondern die Schülerinnen. Es war Tradition in Haus Salem. Beim Fassen der Kleidung wurde den Neuen dann hinter vorgehaltener Hand erzählt, was ihnen blühte. Ich machte einen Knicks vor der Schwester und griff nach Hannas Hand: „Komm, ich zeige dir alles.“
Hannah folgte mir.
„Bist du auch dreizehn?“ fragte ich sie, als wir den Flur entlanggingen.
„Mm“, machte sie. „Und als besondere Geburtstagsüberraschung haben mir meine Eltern eröffnet, dass ich im neuen Schuljahr nach Salem komme.“ Hannah verzog das Gesicht. „Damit ich endlich mal Gehorsam lerne, meinte meine Mutter. Ich sei viel zu frech und ungehorsam, meint sie. Sie war als junges Mädchen auch hier auf der Schule und ist voll des Lobes auf Haus Salem.“ Sie blickte sich missmutig um. „Ich kann nicht verstehen, was sie an dem kahlen, kalten Kasten findet. Hier ist es grässlich.“
„Du wirst dich daran gewöhnen“, sagte ich und lotste sie die Treppe hinunter zur Kleiderkammer.
„Ganz bestimmt nicht!“ gab sie trotzig zurück.
Ich schwieg. Hannah tat mir leid. Es musste besonders schwer sein, als einzige Neue in eine fest gefügte Klassengemeinschaft zu kommen. Damals vor drei Jahren waren wir alle Neue gewesen und hatten in unserer Unsicherheit zusammengehalten, verängstigte Zehnjährige, die nicht wussten, was sie erwartete. Hätte ich es damals gewusst, ich wäre schreiend davongelaufen.
In der Kleiderkammer suchte ich einen kompletten Satz Anstaltskleidung für Hannah zusammen. „Zieh deine Sachen alle aus und gib sie in einen Waschbeutel“, sagte ich. „Sie werden später für dich aufbewahrt. Im Internat ist Privatkleidung verboten.“
Hannah zog sich aus. „Mein Höschen und den BH werde ich ja wohl anbehalten dürfen“, brummelte sie. Sie hatte schon ziemlich gut entwickelte Brüste.
Ich schüttelte den Kopf: „BHs sind verboten. Und das Höschen kannst du auch gleich auslassen. Wenn nicht, musst du eins von der Anstalt tragen.“
Sie blickte mich verdutzt an: „Machst du Witze?! Ich soll ohne Schlüpfer rumlaufen?!“
„Das gehört zum Gehorsamstraining“, entgegnete ich. Immer das Selbe mit den Neuen. Nie konnten sie es glauben. Bis sie das erste Mal von den älteren Schülerinnen richtig rangenommen wurden. Arme Hannah. Auch sie würde es erfahren.
„Willst du mir weismachen, dass du kein Höschen anhast?“
„Sonja Röder hat es so verlangt. Die älteren Mädchen dürfen nach Herzenslust über uns jüngere bestimmen“, gab ich zur Antwort.
„Du lügst doch!“ Hannah stand vor mir. „Oder?“
„Tu ich nicht“, sagte ich leise.
Plötzlich war ihre Hand unter meinem Rock, tastete sich zwischen meinen Oberschenkeln hinauf, eine zarte, flüchtige Berührung wie ein aufgeregter kleiner Vogel. Ihre Fingerkuppen betasteten mich an meiner intimsten Stelle, wo ich vollkommen nackt war, nackt und haarlos. Ich musste ein wohliges Seufzen unterdrücken, als ich ihre Finger dort spürte.
Hannahs Augen weiteten sich vor Ungläubigkeit.
„So ist es hier im Internat“, sagte ich ruhig. „Wenn eine der älteren Schülerinnen dir einen Befehl erteilt, hast du ihn auszuführen.“
„Und wenn ich es nicht mache?“ fragte Hannah. Sie sah mit einem Mal sehr klein und verunsichert aus.
„Du wirst es machen, Hannah“, gab ich zurück. „Die bringen dich dazu. Haus Salem hat noch jedem Mädchen den Willen gebrochen. Das ist ja der Zweck unseres Aufenthaltes hier im Internat: Totalen Gehorsam zu erlernen.“ Ich sc***derte ihr in knappen Worten, was sie erwartete. Beim Zuhören wurden ihre Augen immer größer.
„Das kann doch nicht sein!“ wisperte sie in einem fort. „Das kann einfach nicht sein! Wie können meine Eltern mich hierher schicken?! Meine eigenen Eltern!“
„Am besten, du gewöhnst dich gleich dran“, sagte ich und half ihr, die Anstaltskleidung anzuziehen. Den BH hatte sie abgelegt, das Höschen aber anbehalten. Sie trug noch ihre hellen Socken. „Die müssen runter.“ Ich bückte mich und zog sie ihr aus. Dann erhob ich mich.
Hannah stand in Anstaltskleidung vor mir, dem einfachen kurzen Sommerkleid in tristem Grau mit dem blendendweißen Kragen. Das Kleid endete zwei Fingerbreit über ihren hübschen Knien. Ihre nackten Füße sahen sehr weiß und sehr klein auf dem polierten Parkettboden aus. Sie verkrallte ihre schlanken Zehen, als wolle sie sich am Boden festhalten.
Ich holte ihr Nähzeug aus dem Regal und Handtücher und Bettzeug. Hannah machte mit. Sie sagte nichts. Sie war wie betäubt. Was ich ihr erzählt hatte, hatte sie ganz schön mitgenommen. Wir brachten ihre Sachen nach oben zum Schlafsaal der siebten Klasse unter dem Dach und räumten alles ein.
Erst auf dem Weg nach unten, redete Hannah wieder: „Ich mache da nicht mit!“ Ich hörte den trotzigen Unterton in ihrer Stimme.
„Du musst, ob du willst oder nicht“, sagte ich leise. „Alle müssen das machen. Es gibt keine Ausnahme. Wenn du störrisch bist, werden sie dich umso härter rannehmen. Sie werden deinen Willen brechen, egal wie tapfer du auch bist.“
„Das können die nicht mit mir machen!“ rief sie hitzig.
„Na wen haben wir denn da?“ Wir fuhren herum. Katarina Gerber stand hinter uns. Sie war eine der Schülerinnen der obersten Klasse. Sie musste uns heimlich gefolgt sein. Innerlich rollte ich mit den Augen. Ausgerechnet Katarina! Die war dafür berühmt, dass sie sich besonders intensiv der neuen Schülerinnen annahm, vor allem, wenn diese aufmüpfig waren. Es sah nicht gut für Hannah aus.
„Das ist Hannah Gessner“, stellte ich vor. „Sie ist meine neue Klassenkameradin.“
Katarina musterte Hannah von oben herab: „Ich habe gehört, dass sie sich unseren Regeln nicht unterwerfen will.“ Hannah erwiderte Katarinas Blick trotzig. Ihre Augen flammten geradezu.
„Sie ist noch neu“, beeilte ich mich zu sagen. „Sie wird sich bald einfügen.“
„Das wird sie sofort tun“, schnarrte Katarina und kam auf uns zu. „Stimmt es, dass sie ihr Höschen nicht ausziehen wollte?“ Ich schluckte uns schwieg. Katarina fasste unter Hannahs Rock.
„Rühr mich nicht an!“ zischte die und wich zurück.
„Ach nee!“ sagte Katarina und lächelte. „Eine ganz Kratzbürstige.“ Sie nahm Hannah aufs Korn: „Zieh deinen Schlüpfer aus!“
„Nein!“ rief Hannah und stampfte mit dem nackten Fuß auf. „Das tue ich nicht!“
Katarinas Lächeln wurde breiter: „Wie du meinst. Dann behältst du den Höschen eben an, wenn du so daran hängst.“ Ihre Stimme wurde spöttisch. „Den ganzen Tag lang wirst du es anbehalten.“ Sie langte hinter sich. Ich hörte das verräterische Klirren von Stahl und wusste, was passierten würde.
Hannah war nicht darauf vorbereitet und völlig überrumpelt, als Katarina sie hart packte und ihr die Arme auf den Rücken verdrehte. Katarina fischte ein paar stählerne Handschellen aus ihrer hinteren Rocktasche und ließ sie mit geübtem Griff um Hannahs Handgelenke schnappen. Hannah schrie auf, aber es war zu spät für Gegenwehr. Schon trug sie die Hände auf dem Rücken zusammengefesselt.
Katarina packte sie und zerrte sie zum Klassenraum der Siebten: „Heute trägst du Handschellen, Kratzbürste. Und zwar den ganzen Unterricht über. Gewissermaßen als Willkommensgruß von Haus Salem. Das wird dein Mütchen kühlen.“ Sie grinste breit. „Und das Höschen –dein über alles geliebtes Höschen- behältst du natürlich an. Aber sicher doch.“ Sie nagelte mich mit Blicken fest: „Lass dir nicht einfallen, ihr das Höschen runterzuziehen, Sigrid Schmidt!“
„Nein Katarina“, sagte ich schnell. „Werde ich nicht.“
„Auch sonst keine!“ schnarrte Katarina und klopfte an der Tür. Sie schob die gefesselte Hannah grob in den Klassenraum.
„Das Fräulein war aufmüpfig“, sagte sie zu Schwester Roberta. „Sie wird für den Rest des Unterrichts Handschellen tragen. Und ihr Höschen! Das will sie nämlich partout nicht ausziehen. Also soll sie es während des gesamten Unterrichtes tragen.“
„So?“ machte Schwester Roberta spitz und schaute Hannah an. „Gleich zu Anfang ein großer Auftritt? Na dann…“ Sie zeigte auf die leere Bank: „Geh mit Sigrid Schmidt auf deinen Platz.“
„Komm Hannah“, sagte ich leise und führte Hannah durch den Klassenraum zu unserer Bank. Es war mucksmäuschenstill im Klassenraum. Zu hören war nur das leise Aufpatschen von unseren nackten Fußsohlen. Wir setzten uns, Hannah mit auf den Rücken gefesselten Händen. Ihre Wangen brannten vor Scham. Arme Hannah! Das war erst der Anfang. Ihr stand einiges bevor.
HAUS SALEM, Teil 2
Die folgende Unterrichtsstunde verlief wie gewohnt. Schwester Roberta fragte uns ab und wer aufgerufen wurde, stand auf, ging nach vorne und stellte sich mit dem Gesicht zur Klasse, um die Antwort zu geben. Danach kehrte man zu seinem Platz zurück. Ich spürte förmlich, wie Hannah neben mir vor Scham glühte. Sie hatte Angst, an die Reihe zu kommen. Ich verstand sie sehr gut. Mir war es beim ersten Mal nicht anders gegangen. Ich wäre am liebsten vor Scham im Boden versunken, als ich mit gefesselten Händen nach vorne gehen musste.
„Dorothee Fendt“, sagte Schwester Roberta. „Das Gedicht vom Walde!“
Dorothee stand auf und ging nach vorne. Wir hörten das leise Patschen ihrer nackten Sohlen auf dem Holzboden. Neben mir zog Hannah scharf den Atem ein und blies dann vernehmlich Luft ab. Dorothee war ein kleines, zierliches Mädchen mit schulterlangem rotem Haar und hellen wasserblauen Augen. Ich sah, was Hannah aufgefallen war. Dorothees Hände waren mit einem Seil auf dem Rücken zusammengefesselt. Das war sicher Susanne Eiler gewesen, für die Dorothee diesen Monat als Hilfe eingeteilt war. Susanne war bekannt für solche Spielchen. Dorothee ging nach vorne, als sei nichts weiter, stellte sich mit dem Gesicht zur Klasse und begann das Gedicht zu rezitieren:
„Im Walde unterm Tannenhain, da wo das Häslein ruhet…“
Ich schaute zu Hannah hinüber und erkannte eine gewisse Erleichterung in ihren Augen. Sie war nicht das einzige Mädchen, das gefesselt am Unterricht teilnahm. Sie wollte mich etwas fragen. Entsetzt schüttelte ich den Kopf und hielt den Zeigefinger vor die Lippen. Nicht sprechen! Schwatzen im Unterricht war verboten und wurde hart bestraft. Hannah schluckte, drehte den Kopf nach vorne und lauschte Dorothees Vortrag.
In der nächsten Stunde hatten wir Biologie. Es ging um den Unterschied zwischen Hasen und Kaninchen. Hannah rutschte schon eine ganze Weile nervös auf ihrem Stuhl herum. Endlich stand sie auf: „Schwester Roberta?“
Der Kopf der Schwester ruckte hoch: „Ja Hannah Gessner?“
Hannah schaute beschämt zu Boden: „Bitte Schwester. Ich muss austreten. Darf ich bitte zur Toilette gehen?“
„Komm nach vorne, Mädchen“, verlangte Schwester Roberta. Hannah gehorchte und stellte sich vorne vor die Klasse. Sie war rot geworden. Sie schämte sich, das sah ich deutlich.
„Mach!“ sagte Schwester Roberta.
Hannah begriff nicht: „Pardon?“
„Mach!“ schnarrte die Nonne. „Du hast doch gesagt, dass du musst.“
Hannahs Augen wurden riesengroß: „Hier? Im Klassensaal?“
„Allzuviel wird nicht auf den Boden laufen“, meinte die Schwester lakonisch. „Da du darauf bestanden hast, dein Höschen anzubehalten, wird es das Meiste aufsaugen. Den Rest wirst du nach Unterrichtsende aufwischen. Mach oder geh zurück auf deinen Platz.“
„D…das kann ich nicht!“ rief Hannah entgeistert. Sie wurde puterrot.
Ein harter Zug erschien um Schwester Robertas Lippen: „Mädchen, noch einmal sage ich es nicht! Mach los!“
„Nein!“ rief Hannah laut. „Das können Sie nicht von mir verlangen.“
„Jetzt reichts!“ Die Schwester stand auf und ging zur Tür. Sie öffnete sie, zog ihre Trillerpfeife aus der Kutte und pfiff gellend. Draußen auf dem Gang öffneten sich Türen und Schritte näherten sich. Ein paar von den größeren Mädchen erschienen, allen voran Katarina Gerber: „Schwester Roberta?“
Die Nonne zeigte auf die feuerrote Hannah: „Kartengalgen!“ Sie reichte Katarina das kleine Schlüsselchen, mit dem sie Hannahs Handschellen aufsperren konnte.
Die fünf älteren Mädchen packten Hannah unsanft und hielten sie fest. Katarina öffnete die Handschellen. Ich sah den ungläubigen Schrecken in Hannahs Augen. Als ich ihr erzählt hatte, wie es in Haus Salem zuging, hatte sie sich geweigert, mir Glauben zu schenken. Nun sollte sie es erleben. Arme Hannah! Sie tat mir so leid. Aber sie würde sich daran gewöhnen wie wir alle. Sylvia Fricker trat hinter den Kartengalgen, ein massives Ding aus Holz, und ließ die Querstange herunter, an der normalerweise die großen Landkarten für Erdkunde aufgehängt wurden. Petra Volz und Vanessa Dahl packten Hannah an den Handgelenken und zerrten sie zu der Stange. Hannah wehrte sich erbittert. „Lasst mich los!“ schrie sie. „Ihr sollt mich loslassen!“ Aber gegen die Kraft der größeren Mädchen kam sie nicht an. Die beiden zogen ihre Arme auseinander, bis sie waagrecht an der Querstange gestreckt waren. Sonja Röder rückte mit kurzen Seilen an. Sie umwickelte Hannahs Handgelenke mit mehreren Windungen Schnur und wickelte dann das Seil zusätzlich um die Querstange. Schon stand Hannah mit ausgebreiteten Armen wehrlos am Kartengalgen, an den Handgelenken an die Stange gefesselt.
„Hoch mit ihr!“ befahl Katarina. Sylvia und Nadja zogen hinten an der Leine und die Querstange hob sich in die Höhe. Hannah wurde langsam nach oben gezogen. Ihre nackten Füße baumelten hilflos in der Luft. In einer Höhe von einem Meter überm Boden gab es ein Brettchen vorne am aufrechten Mast des Kartengalgens. Dort konnte man Kreide oder einen Zeigestock ablegen. Die großen Mädchen stellten Hannahs nackte Füße auf das Brettchen. Katarina Gerber nahm ein Seil und fesselte Hannahs Füße an den Fußgelenken fest zusammen. Sie zog das Seil auch zweimal zwischen Hannahs Füßen hindurch. Schließlich machte sei es am aufrechten Mast fest und machte mit hochgerecktem Daumen ein Zeichen: „Streckt sie!“
Sylvia und Nadja zogen an der Leine. Hannahs Körper wurde leicht in die Höhe gehoben und gestreckt.
„Weiter!“ befahl Katarina.
Endlich stand Hannah nur noch auf ihren Zehen.
„Gut!“ befand Katarina. „Leine festmachen!“ Nadja verknotete die Halteleine hinterm Mast an einem Haken.
„Vielen Dank Mädchen“, sprach Schwester Roberta. „Ihr könnt gehen.“
„Schwester Roberta“, sagten die großen Mädchen. Sie knicksten und verließen den Raum.
Hannah hing hilflos am Kartengalgen.
„So“, sagte Schwester Roberta. „Da bleibst du hängen, bis du gemacht hast. Und danach gleich noch länger, damit du spürst, was es heißt, widerborstig zu sein. Das wird in Haus Salem nicht geduldet. Wollen wir doch mal sehen, ob wir dir deine Flausen nicht austreiben können, du kleiner Trotzkopf!“
HAUS SALEM, Teil 3
Schwester Roberta setzte ihren Unterricht ungerührt fort. Hannah hing hilflos am Kartengalgen wie eine Gekreuzigte. Ich sah, wie sehr sie sich schämte. Dabei konnte sie von Glück sagen, dass die größeren Mädchen ihr das Kleid angelassen hatten. Mit Schaudern erinnerte ich mich daran, als man mich zum ersten Mal ganz ausgezogen hatte, bevor ich vor der versammelten Klasse gefesselt wurde. Fast elf war ich damals gewesen und hatte genau wie Hannah am Kartengalgen gehangen. Ich war vor Scham vergangen. Alle konnten sehen, dass ich nackt war. Es war entsetzlich. Später gewöhnte ich mich daran, wie auch an alles andere. Das blieb nicht aus. Aber an den Kartengalgen ging ich nur ungern. Der Galgen war berüchtigt. Der kriegte jede klein. Oh, zu Anfang war es gar nicht schlimm, mit ausgebreiteten Armen gefesselt zu sein. Es zog ein bisschen in der Brust und an den Armen und es war unbequem, auf den Zehen zu stehen, aber weh tat es nicht. Aber die Zeit war die Waffe, die der Galgen gegen ein gefesseltes Mädchen führte. Schon nach zehn Minuten fing es an unbequem zu werden. Nach einer Stunde war es nicht mehr auszuhalten und wehe dem Mädchen, das einen halben Tag am Kartengalgen verbringen musste. Dies geschah meistens nachmittags, denn vormittags hätte sie mit ihrem Gejammer und Schluchzen den Unterricht gestört.
Ich schaute Hannah verstohlen an. Sie litt. Zum einen war da die ungeheure Scham. Zum anderen musste sie wirklich dringend pieseln. Ich sah, wie sie die Beine zusammenpresste und das Gesicht verzog. Schwester Roberta achtete nicht auf Hannah. Sie tat, als wäre sie überhaupt nicht da. Ungerührt erklärte sie uns, wie Kaninchen Gras verdauten und dass sie im Gegensatz zu Feldhasen nackte blinde Junge zur Welt brachten, und dass Kaninchen kurze und Hasen lange Ohren hatten.
Hannah bekam davon nicht viel mit. Sie presste immer heftiger die Beine zusammen. Ich konnte sehen, wie sie ihre Zehen verkrampfte. Sie hielt es mit aller Gewalt an. Arme Hannah. Es würde ihr nichts nützen. Die Schwester würde sie auf alle Fälle solange am Kartengalgen hängen lassen, bis sie sich ins Höschen gemacht hatte. Sie würde Hannah nicht davonkommen lassen, sondern gleich am ersten Tag den Willen des Mädchens brechen. Und an den folgenden Tagen immer wieder, solange bis Hannah widerspruchslos gehorchte wie wir anderen Mädchen. Haus Salem machte auch aus den wildesten Rangen brave, folgsame Mädchen. Deswegen schickten unsere Eltern uns ja hierher.
Hannah warf mir einen verzweifelten Blick zu. Sie tat mir entsetzlich leid. Gerne hätte ich ihr geholfen, doch das war natürlich verboten. Sie sah erbarmungswürdig aus. Noch zehn Minuten, dann war die Stunde zu Ende. Ich wusste, dass Hannah vorher kapitulieren würde. Sie zog sich mit den Armen hoch, um ihre Zehen zu entlasten. Dann reckte sie sich auf den Zehen in die Höhe, um dem unangenehmen Zug auf ihre Arme und Schultern zu entkommen. Wenn einem die Arme fast waagrecht an die Querstange gefesselt wurden, lag ein hoher Zug auf ihnen und auf dem Brustkorb. Sackte man zu tief nach unten, konnte man nicht mehr richtig Luft holen. Dann musste man sich mit den Füßen wieder abstoßen. Es war ein langsamer, qualvoller Tanz, auf und ab, immer wieder.
Fünf Minuten vor Ende der Biologiestunde verlor Hannah den Kampf gegen ihre übervolle Blase. Ihre Augen wurden groß, als sie merkte, dass sie es nicht länger halten konnte. Ihr Gesicht verzerrte sich. Noch einmal versuchte sie es aufzuhalten. Dann musste sie es laufen lassen. Ein dünnes Bächlein rann an der Innenseite ihres linken Beins hinunter über ihren Fuß und plätscherte auf den Parkettboden. Hannahs Gesicht lief violett an vor Scham.
Schwester Roberta tat, als hätte sie nichts bemerkt. Erst als die Stunde zu Ende war, stand sie auf und trat vor Hannah. „Nun? Wie ich sehe, hast du es dir anders überlegt“, sagte sie schroff. „Möchtest du jetzt dein Höschen ausziehen? Hm? Merk dir das ein für alle Male, Mädchen: Bei uns kommst du mit Widerborstigkeit nicht durch. Und damit du lernst, wirst du dein nassgemachtes Höschen bis zum Mittagessen anbehalten. Bedanke dich bei mir dafür, dass ich dir Gehorsam beigebracht habe.“
Hannah schnappte nach Luft. Sie brachte vor Verblüffung kein Wort heraus. Das war ihr Pech. Schwester Roberta zuckte die Achseln: „Wie du willst. Du wirst schon noch klein beigeben. Wenn du weichgekocht bist, sehen wir weiter. Du bleibst den Rest des Unterrichts am Kartengalgen hängen.“
Wir schauten voller Mitleid zu Hannah hoch. Die Arme! Bis Schulschluss war es noch lange. Das würde hart für sie werden. Für fünf Minuten durften wir nach draußen auf den Schulhof, ein wenig frische Luft schnappen.
„Mensch, die hat es ja gleich drauf ankommen lassen“, sagte Sarah Lauer und schüttelte ihr schulterlanges Haar.
„Hast du sie denn nicht gewarnt, Sigrid?“ fragte Judith Ecker.
„Natürlich habe ich das“, antwortete ich. „Aber sie hat mir nicht geglaubt.“
„Die alte Leier“, meinte Monika Düsterbeck und spielte mit ihren langen blonden Zöpfen. „Sie glauben es nicht, bis sie es erleiden.“
„Es macht eh keinen Unterschied“, fand Miriam Schwarz. Ihr Name wirkte seltsam unpassend. Schwarz! Dabei war sie hellblond und hatte helle wasserblaue Augen. „Egal ob sie pariert oder sich wehrt, sie wird die volle Behandlung erfahren wie wir alle, nur mit dem Unterschied, dass sie eben noch ein Weilchen ungehorsam ist. Das waren wir am Anfang auch. Ich kann mich erinnern, dass ich unheimlich frech war.“ Sie lachte. „Das haben mir die älteren Mädchen und die Nonnen ganz schnell abgewöhnt.“
„Oder Gudrun, wisst ihr noch?“ fragte Judith. Wir nickten. Gudrun hatten wir Mitte des letzten Schuljahres als Neuzugang bekommen. Gudrun war blond und blauäugig wie ein Engel und frech wie sonst was. Sie hatte den Nonnen und den älteren Schülerinnen einen heißen wochenlangen Kampf geliefert, bevor sie endlich aufgab und gehorsam wurde. Ob wir mit Hannah ähnliches erleben würden?
„Mir tut sie leid“, sagte Monika. „Sie hat Angst. Das habe ich gesehen.“
„Ja“, gab ich ihr Recht. „Doch wir können ihr nicht helfen. Wenn es vorbei ist, werde ich sie trösten.“
Monika umarmte mich. „Tu das, Sigrid. Sie wird Trost dringend nötig haben.“
Es klingelte zum Pausenende und wir gingen wieder rein.
Schwester Roberta begann uns mit Mathematik zu traktieren. Ich hasste Mathe. Sollte sie sich ihre blöden Formeln doch an den Hut stecken! Hannah hing hilflos am Kartengalgen, den Kopf beschämt gesenkt. Unter ihren Füßen stand eine kleine Pfütze. Was für eine Erniedrigung, vor der gesamten Klasse Pipi machen zu müssen. Schwester Roberta war echt hart. Schwester Jakoba hätte Hannah vielleicht auf die Toilette gehen lassen. Aber wer die Hände mit Handschellen auf dem Rücken zusammengefesselt hat, kann sich zum Pinkeln das Höschen nicht runterziehen. Nassgemacht hätte sich Hannah auf alle Fälle, aber wenigstens nicht vor der ganzen Klasse.
Sie hob den Kopf und drückte die Beine durch, um den Zug auf ihre Arme zu lindern. Ich erkannte, dass es ihr bereits sehr unangenehm war. Noch zwei Schulstunden. Ob Hannah das aushalten würde? Sie war zäh, das musste ich ihr zugestehen, aber zweieinhalb Stunden am Kartengalgen brachen jeden Widerstand. Irgendwann würde sie anfangen zu betteln. Sie würde anfangen zu weinen und Schwester Roberta anflehen, sie zu befreien. Ihr Wille würde gebrochen werden. Da half keine Tapferkeit und keine Zähigkeit. Irgendwann klappte jede zusammen. Der Kartengalgen kannte keine Gnade und kein Mitleid. Wie so oft bei solchen Gelegenheiten überlegte ich, ob drüben in der Jungenschule ähnliche Zustände herrschten. In der Jungenschule hatten Pater das Sagen und die waren genauso streng wie unsere Nonnen.
Hannah zog sich wieder an den Armen hoch. Sie zitterte. Ihr Gesicht hatte einen gequälten Ausdruck angenommen. Noch bemühte sie sich, sich ihr Unbehagen nicht anmerken zu lassen, aber lange würde sie nicht mehr durchhalten. Sie bog den Kopf zurück und schien irgendwie zu versuchen, sich ans Holz des Kartengalgens anzulehnen. Wieder drückte sie die Beine durch, um den Zug auf ihre Brust zu lindern. Ein leises Stöhnen entrang sich ihrer Kehle. Alle in der Klasse registrierten das kleine Geräusch, aber keine lies sich etwas anmerken. Wir alle wussten, was Hannah gerade durchmachte. Wir konnten ihr nicht helfen.
Schwester Roberta unterrichtete Mathematik und beachtete Hannah nicht. Endlich ging die Stunde zu Ende. Wieder hatten wir eine kurze Pause und trafen uns draußen auf dem Schulhof.
„Lange macht sie es nicht mehr“, prophezeite Judith. „Sie hat gestöhnt. Damit fängt es an. Zwei oder dreimal stöhnen und dann fließen die ersten Tränen.“
Gudrun stieß zu uns. Sie stieg auf das eiserne Geländer das den oberen vom unteren Schulhof trennte und balancierte barfüssig über den schmalen Handlauf: „Sie hat Mut, diese Hannah. Sie ist wie ich.“
„Und?“ fragte Monika. „Hat es dir letztes Jahr was genützt?“
Gudrun balancierte ungerührt weiter, eine schlanke zierliche engelhafte Gestalt auf dem schmalen Geländer. Die Sonne ließ ihr hellblondes Haar aufglühen. „Hat es dir was genützt, gleich klein beizugeben, Monika?“ fragte sie zurück. „Ich habe es den Pinguinen jedenfalls nicht leicht gemacht.“
Wir hielten die Luft an und schauten uns erschrocken um. Wenn eine der älteren Schülerinnen mitbekam, dass wir die ehrwürdigen Schwestern so nannten, war was fällig.
Gudrun hielt die Arme waagrecht vom Körper und hob ein Bein hoch. Sie sah aus wie eine Seiltänzerin: „Ihr Schisshasen. Es ist keine Petze in der Nähe.“ Sie lachte uns aus. Beinahe wäre sie vom Geländer gefallen. In einem eleganten Sprung kam sie auf dem Boden auf. Staub wirbelte auf. Der Boden des Schulhofes bestand aus festgetretener Erde. „Ihr Angsthasen!“
„Red du nicht so“, sagte Monika. „Du gehorchst ja auch.“
Gudrun schaute Moni an: „Da hast du Recht. Aber es besteht ein Unterschied zwischen Gehorsam und jemandem in den Hintern zu kriechen. Letzteres werde ich nie tun. Ich behalte meine eigene Meinung. Diese Hannah ist wie ich. Sie könnte meine Schwester sein. Es tut mir richtig leid, dass sie gleich heulen wird, die Arme. Die blöden Pinguine! Ich wünsche den Schwestern Hämorroiden so dick wie Medizinbälle! Diese Quälgeister! Nie können sie genug kriegen.“
Es klingelte und wir liefen nach drinnen.
In der folgenden Stunde hatten wir Deutsch. Schwester Roberta ließ uns Abschnitte aus dem Deutschen Sagenschatz vorlesen. Wehe, man trug seinen Part nicht richtig vor. Dann durfte man ihn zwanzigmal abschreiben.
Hanna hielt noch bemerkenswert lange durch. Eine halbe Stunde tanzte sie ihren langsamen, qualvollen Tanz am Kartengalgen, ohne einen Mucks von sich zu geben. Ihr Gesicht sprach allerdings Bände und ihre Beine und Arme begannen immer häufiger zu zittern, weil sie ermüdeten. Eine Viertelstunde vor Schluss gab Hannah einen Wehlaut von sich. Tränen schossen ihr in die Augen. Sie wehrte sich dagegen, aber die Tränen flossen ungehindert. Sie begann zu stöhnen, erst leise, dann gotterbärmlich. Schließlich schluchzte sie laut auf.
„Ich kann nicht mehr! Bitte Schwester Roberta, ich kann nicht mehr!“ rief sie weinend. Es war so weit. Ihr Widerstand war gebrochen. Die Schwester hatte sie da, wo sie sie haben wollte. Doch vorerst tat sie, als hätte sie Hannahs Flehen nicht gehört. Ich hasste es, wenn die Nonnen das machten. Auch die älteren Mädchen taten es gerne. Nur Sonja nicht. Meine geliebte Sonja!
Hannah weinte lauter. „Bitte!“ rief sie. „Es tut so weh! Bitte lassen Sie mich frei, Schwester Roberta. Ich will auch artig sein. Bitte!“
Die Schwester setzte ungerührt den Unterricht fort.
Hannah begann laut zu schluchzen. Sie weinte. Sie heulte. Sie flehte.
Endlich trat Schwester Roberta vor den Kartengalgen. „Wirst du nun gehorsam sein?“ fragte sie.
„Ja! Ja!“ rief Hannah verzweifelt.
„Ja Schwester Roberta!“ schnarrte die Nonne.
„Ja Schwester Roberta“, rief Hannah schluchzend.
Die Schwester winkte uns: „Nehmt sie runter.“ Zusammen mit Monika, Judith und Gudrun lief ich nach vorne und half, die arme Hannah zu erlösen. Sie schluchzte in einem fort.
„Knie nieder und bedanke dich bei mir dafür, dass ich dich Gehorsam lehre“, verlangte Schwester Roberta.
Wir hielten den Atem an. Würde Hannah widersprechen? Dann ging der Tanz von vorne los.
Hannah ließ sich auf die Knie fallen. „Danke Schwester Roberta, dass sie mich Gehorsam lehren“, schluchzte sie. „Danke.“
Die Schwester war befriedigt. „Lass dir von Sigrid Schmidt zeigen, wo das Putzzeug ist und wisch den Boden vorm Kartengalgen auf, bevor du zum Mittagessen gehst“, befahl sie.
„Ja Schwester Roberta“, sagte Hannah unter Tränen. Ich schaute sie an. Hannahs Wille war gebrochen. Fürs erste jedenfalls. Die Nonne rauschte davon.
Hannah kniete schluchzend am Boden, ein weinendes Häufchen Elend.
Ich half ihr aufstehen: „Komm Hannah. Ich zeige dir, wo das Putzzeug ist. Wir müssen noch vor dem Mittagessen fertig werden.“
HAUS SALEM, Teil 4
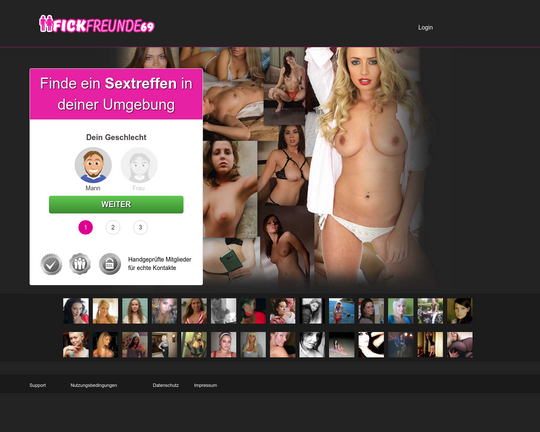
Ich stützte Hannah, während ich sie zur Putzkammer führte. Sie lief auf ziemlich wackligen Beinen.
„Auuu!“ jammerte sie unter Tränen. „Mir tut alles weh.“ Sie rieb ihre Schultern. „Ich kann die Arme fast nicht mehr bewegen. Alles ist steif geworden. Gott, hat das zum Schluss wehgetan.“
„Ich weiß“, sagte ich. „Ich kenne es. Zu Beginn ist es halb so wild, aber nach einer Stunde wird es unerträglich und von dem Auf- und Ab-Gehampel fangen die Muskeln in Armen und Beinen an zu zittern, weil sie total ausgelaugt werden.“
Wir holten Putzlappen und füllten einen Eimer mit Waschlauge. Damit kehrten wir in den Klassenraum zurück und wischten den Boden unter dem Kartengalgen. Hannah weinte noch immer, als sie auf Knien den Boden reinigte. Sie blickte mich an: „Wird das öfter passieren?“
Ich nickte stumm.
„Aber … aber das ist unmenschlich! Ich habe mich so geschämt und es tat weh.“ Sie schaute mich an und ich erkannte die Verzweiflung in ihren Augen. „Ist wirklich alles wahr, was du mir in der Kleiderkammer erzählt hast? Alles?! Werden die solche Sachen mit mir machen? Ständig?“
Wieder konnte ich nur stumm nicken. Hannah tat mir leid. Ich konnte ihre Verzweiflung fast körperlich spüren. Erst wenn man sie völlig zerbrochen hatte, würde sie es hinnehmen. Vorher würde sie kämpfen und sich nach Kräften wehren. Sie konnte gar nicht anders. Aber sie würden sie kleinkriegen. Haus Salem kriegte jedes Mädchen klein.
„Das ist unmenschlich!“ sagte Hannah noch einmal, als wir das Putzzeug wegbrachten. Sie weinte noch immer. Sie konnte überhaupt nicht mehr aufhören zu weinen. „Wie konnte Mutti mir das antun? Wo sie doch wusste, was man hier mit mir anstellen würde! Sie war selbst auf dieser Schule. Wie konnte sie nur?“
„Meine war auch in Haus Salem“, antwortete ich. „Sie kam mit zwölf her und blieb bis zur Oberstufe. Sie hat mir von klein auf gesagt, dass ich auch nach Haus Salem kommen würde, damit ich lerne, was Gehorsam ist. Ich kam mit zehn hierher in die unterste Klasse.“
Hannah blickte mich durch einen Tränenschleier hindurch an: „Sie wissen es und trotzdem schicken sie uns hierher!“ Sie war völlig fassungslos. „Wie kann man nur! Das eigene Kind!“
Wir packten das Putzzeug weg.
„Hör mal, Hannah, willst du nicht noch fix dein nasses Höschen ausziehen und dich waschen?“ fragte ich. „Wir haben noch ein paar Minuten bis zum Mittagessen.“
„Ja“, sagte sie leise. Wieder schaute sie mich an. „Es war so … so erniedrigend, Sigrid. Ich habe mich so geschämt.“
„Ja“, entgegnete ich. „Das gehört dazu. Das tun sie oft. Die Scham soll dich in die Knie zwingen. Sie soll dabei mithelfen, deinen Willen zu brechen.“
„Jeden Tag jeder Woche“, sagte sie tonlos. „Das ganze Schuljahr lang …“ Ihre Tränen versiegten. Unendliche Angst stand in ihren Augen. „Ich fühle mich jetzt schon total gebrochen. Wirklich, Sigrid.“
Ich schluckte. Hannah hatte keine Ahnung, was ihr noch bevorstand.
Noch einmal begehrte sie auf: „Das können die doch nicht mit mir machen! Das halte ich nicht aus!“
„Doch Hannah“, sagte ich. „Du wirst es aushalten. Jede muss es aushalten. So geht es nun mal zu in Haus Salem.“ Ich half ihr, sich zu waschen. Sie zog ein frisches Höschen an. Diesmal noch. Dann liefen wir zum Mittagessen. Wir schafften es im letzten Moment.
HAUS SALEM, Teil 5
Nach der Mittagspause kam die kleine Carmen aus der untersten Klasse vorbei und teilte mir mit, dass ich zu Sonja Röder zu kommen habe. Ich folgte der Aufforderung sofort. Erstens war ich es gewohnt, widerspruchslos zu gehorchen und zweitens mochte ich Sonja. Anfangs war ich sogar ein wenig in die verknallt gewesen, als ich als Zehnjährige nach Haus Salem kam. Ich verfolgte die ältere Schülerin wochenlang mit schulmädchenhafter Verliebtheit und lief ihr wie ein Hündchen nach in meiner glühenden Verehrung für sie. Sonja war genauso unerbittlich in der Anwendung der Gehorsamslektionen wie alle anderen, aber sie war nicht wie Katarina Gerber und Petra Volz, denen es Spaß machte, jüngere Schülerinnen zu triezen. Sonja suhlte sich nicht in der Macht, die sie über Jüngere ausübte. Ich hatte noch nie so etwas wie Gehässigkeit an ihr verspürt. Sie tat, was zu tun war, aber sie tat es so, als hätte sie eine normale Schulaufgabe zu erledigen. Was nicht bedeutete, dass sie nachgiebig gewesen wäre. Oh nein. Aber sie behandelte uns jüngere Schülerinnen mit Respekt und Achtung. Die Lektionen sollten unseren Willen brechen, nicht die Gemeinheit einer höherstehenden Schülerin. Dafür mochte ich Sonja noch immer sehr.
In ihrem Zimmer musste ich als erstes die Fenster putzen und dann Staub wischen. Sie hatte einige Schülerinnen der oberen Jahrgänge zu Besuch und trank mit ihnen Tee (den natürlich ich zubereiten musste). Sie unterhielten sich angelegentlich über den Neuzugang in der Siebten.
„Sie ist noch nicht enthaart“, meinte Susanne Eiler. „Sollten wir nicht schon heute Nachmittag loslegen?“
„Lasst sie“, entgegnete Sonja. „Hannah Gessner hat fürs Erste genug. Sie ist völlig fertig. Wir wollen ihren Willen brechen, nicht ihr Kreuz. Wir machen es morgen.“
Ich liebte Sonja für diese Sätze.
Sie reckte und streckte sich auf ihrem Sessel. Dann stand sie auf. „Komm her, Sigrid“, sagte sie zu mir.
Folgsam unterbrach ich das Staubwischen und ging zu ihr. Sie holte einen kurzen Strick aus einer Schublade ihrer Kommode: „Dreh dich um! Hände auf den Rücken!“
Gehorsam drehte ich mich um und kreuzte die Handgelenke hinterm Rücken. Ich hatte längst aufgegeben, mich zu wehren. Sich zu wehren war zwecklos. Und irgendwo tief in mir drinnen war im Lauf der Zeit eine gewisse Befriedigung herangewachsen, mich bedingungslos hinzugeben, mich auszuliefern, alles hinzunehmen, was sie mir antaten. Ich verstand es nicht recht, aber so sehr ich auch die Lektionen fürchtete, ich liebte den Gedanken daran genauso. Ob das das tiefe Geheimnis des Gehorsamstrainings von Haus Salem war? Würde ich zum guten Schluss als Oberschülerin überhaupt keine Abneigung mehr gegen die Lektionen verspüren, egal wie hart sie waren? Würde ich nur noch Hingabe empfinden? Unvorstellbar! Und doch schien es so zu kommen. Alle Zeichen sprachen dafür. Es begann Spaß zu machen, nicht aufmüpfig zu sein, sondern sofort zu gehorchen.
Ich spürte, wie Sonja meine überkreuzten Handgelenke mehrfach mit dem Strick umwand. Sie führte das Seil auch zwischen meinen Handgelenken hindurch, damit ich nur ja nicht aus der Fesselung entwischen konnte. Schließlich machte sie einen festen Doppelknoten. Ich war hilflos gefesselt. Sonja holte eine Sicherheitsnadel. Sie zog den vorderen Rockteil ihres grauen Anstaltskleides hoch und befestigte ihn mit der Nadel weiter oben, so dass ihr Schoß offen lag. Sie war wie alle Schülerinnen von Haus Salem unbehaart.
Sonja ging zum großen X. Jede Oberschülerin hatte so ein Gestell im Zimmer stehen. Sie griff nach den beiden oberen Ringen, hielt sich mit den Händen daran fest und spreizte die Beine. An ihren Händen hängend stand sie vor mir wie ein aufgespreiztes menschliches X und bot ihren nackten Schoß dar: „Komm, Sigrid, und tu, was du zu tun hast!“
Folgsam kniete ich vor ihr nieder. Für einen Moment betrachtete ich ihre nackte Muschi. Sonja hatte keine Haare dort. Sie wurde genau wie wir alle, in regelmäßigen Abständen enthaart. Allen Schülerinnen blühte das. Die Haare wurden mit einer Pinzette ausgezupft. Nach drei oder vier Monaten begannen sie nachzuwachsen und wurden wieder ausgerissen. Eine ziemlich unangenehme Prozedur, aber wer hätte gewagt, sich dagegen zu wehren?
Ich beugte mich vor und küsste die zarte Haut von Sonjas Lustfurche. Mit den Lippen machte ich sanfte kauende Bewegungen und bewegte den Kopf langsam hin und her, auf und ab. Ich spürte, wie ihr Fleisch vor Erregung warm wurde. Sonja gab keinen Ton von sich. Sie war dafür bekannt, keinen Mucks von sich zu geben, wenn sie von uns jüngeren Mädchen mit dem Mund befriedigt wurde. Andere Große stöhnten laut und sie wanden sich vor Lust. Sonja nicht. Sie hielt still und schwieg wie ein Grab. Es war schwer zu erraten, wie sehr wir sie erregten. Ich streckte die Zunge zwischen ihre erhitzten Lippen und zerteilte sie sanft. Langsam fuhr ich in Sonjas weicher Furche aufwärts bis zu ihrer Lustknospe. Sonja gab keinen Ton von sich, doch ich schmeckte ihr leicht salziges bitteres Aroma, als sie feucht wurde. Und ob sie es genoss!
Der Teufel ritt mich. Ich brachte mein Gesicht näher an ihre erregte Möse heran und begann, ihr süßes, kleines Knöpfchen unendlich zart mit meinen Zähnen zu beknabbern. Ein kurzer Stöhnlaut entrang sich Sonjas Kehle. Hah! Ich hatte es geschafft! Sie hatte gestöhnt.
Sofort hatte Sonja sich wieder in der Gewalt. Ich leckte und knabberte weiter, arbeitete mich mit Lippen und Zunge ihre Lustgrotte hinauf und hinunter. Wann immer ich oben ankam, wo unter dem wunderbar weichen dicken Hügelchen ihre Knospe saß, knabberte ich sanft mit den Zähnen daran. Sonja gab keinen Laut mehr von sich, aber ihre erregte Muschi reckte sich mir freudig entgegen. Das konnte sie nicht unterdrücken.
Ich aber unterdrückte ein triumphierendes Grinsen. Ich kniete barfuss und mit auf den Rücken gefesselten Händen vor dem älteren Mädchen und musste es mit dem Mund befriedigen. Ich sollte eigentlich Erniedrigung und Machtlosigkeit empfinden, totale Wehrlosigkeit und Hilflosigkeit. Aber ich wusste es besser. Nicht ich war die Ausgelieferte in diesem komplizierten Spiel, sondern Sonja. Sie war es, die mir und meinen Lippen, meiner Zunge und meinen Zähnen ausgeliefert war. Sie war es, sie stillhalten musste und ich war diejenige, die die absolute Macht über die Situation hatte, ich die demütig Kniende!
Je länger ich ihre Furche bearbeitete, desto weniger konnte Sonja still halten. Sie zog sich mit den Händen in die Höhe, ihr Becken reckte sich mir verführerisch entgegen; ihre erregte Möse kam meinem Mund so weit wie möglich entgegen. Ihr Atem ging immer heftiger. Probeweise zog ich meinen Kopf ein wenig zurück. Prompt reckte sich mir Sonjas Unterleib weiter entgegen. Ich entzog mich weiter ihrem Schoß und hörte Sonja keuchen, ein kurzer abgehackter Laut, der fast ein Stöhnen war. Sie reckte sich mir noch weiter entgegen.
Da beugte ich mich vor und ließ meine Zunge wieder fleißig auf und abspielen. Als ich ihre Lustknospe erreichte, ließ ich meine Zungenspitze mehrmals schnell um sie herumkreisen. Und wieder entriss ich Sonja ein kurzes Stöhnen. Ich konnte ein triumphierendes Grinsen nicht mehr unterdrücken.
Du gehörst mir, dachte ich. Du gibst dich mir hin. Ich bin diejenige, die die Situation kontrolliert. Wenn ich auf der Stelle aufhören würde, würdest du mich anbetteln, weiterzumachen. Die Vorstellung erregte mich über die Maßen. Sonja gefesselt und wehrlos und mich anflehend: „Bitte Sigrid, hör nicht auf! Bitte mach weiter! Bittebitte!“ Eine herrliche Vorstellung!
Noch fleißiger bearbeitete ich Sonjas Muschi. Ich rückte ihr auf die Pelle und ließ meine Zunge immer schneller kreisen und auf und ab fahren. Plötzlich verkrampfte sich Sonjas ganzer Körper. Ich hörte ein Keuchen von ihr. Dann begann ihre Möse zu zucken. Sie kam. Ich machte weiter, als hätte ich nichts bemerkt und setzte ihr mit meiner Zunge und den Lippen noch mehr zu. Nach einer Minute spürte ich, dass Sonja einen weiteren Orgasmus bekam. Diesmal schaffte sie es nicht, still zu bleiben. Sie gab ein langgezogenes Stöhnen von sich, bevor sie zusammensackte. Ihr Atem ging immer noch heftig.
„Es ist gut, Sigrid. Du kannst aufhören“, sagte sie und ihre Stimme klang seltsam hoch.
Gehorsam zog ich den Kopf zurück und blickte sie, auf den Knien liegend an. Ihr Gesicht war leicht verschwitzt.
Sonja öffnete die Sicherheitsnadel und ließ das Vorderteil ihres Kleids vor ihren Unterleib fallen, als sei nichts gewesen. Aber ich wusste es besser.
Sie strich mir mit der Hand übers Haar. „Du warst brav, Sigrid.“
„Danke, dass du mir Gehorsam beibringst, Sonja“, sagte ich folgsam. Ich überlegte, ob ich aufstehen durfte. Da sah ich, wie Sonja zu ihrer Kommode ging und weitere Seile aus einer Schublade nahm. Nein, das war noch nicht vorbei für mich.
HAUS SALEM, Teil 6
Sonja kam mit den Seilen zu mir und gab mir einen leichten Schubs: „Zum Fesselrahmen, Sigrid!“
Gehorsam rutschte ich über den Boden zum großen X hin. Das war ein hoher quadratischer Rahmen aus stabilen Holzbohlen, die im Boden verankert waren. Von oben bis unten waren in regelmäßigen Abständen stabile Metallösen eingeschraubt. So konnte man ein Mädchen auf verschiedenste Arten an oder besser in diesen Rahmen fesseln. Auch die obere Querbohle besaß etliche Halteösen.
Ich musste mich auf Anweisung Sonjas auf den Bauch legen. Aha, die Fußsohlen also. Wie so oft. Schläge auf die nackten Sohlen gab es in Haus Salem fast täglich. „Die Füße weich klopfen“ nannte Sonja das. „Pitsch-Patsch“, sagten die jüngeren Mädchen dazu. Manchmal schlugen die älteren Mädchen oder die Nonnen uns nur leicht, so dass man nicht mal zusammenzuckte, dann wiederum so fest, dass wir ab und zu vor Schmerz kurz aufschrieen und oft gab es so harte Schläge, dass wir anfingen zu weinen und um Gnade bettelten. Petra Volz war dafür berüchtigt, dass sie sofort so gnadenlos auf die nackten Fußsohlen der jüngeren Mädchen eindrosch, dass sie anfingen zu schreien.
Sonja schlug zu Beginn der Behandlung nie fest. Sie fing langsam an und steigerte die Härte der Schläge kontinuierlich. So konnte man sich ans Geschlagenwerden gewöhnen.
Sie kniete hinter mir nieder und packte meine Füße. Mit einem kurzen Strick fesselte sie die zusammen und zog dabei das Seil auch zweimal zwischen den Fußgelenken hindurch, damit ich mich nicht herauswinden konnte. Anschließend verband sie die Handfesseln mit den Fußfesseln, so dass meine Hände und Füße auf dem Rücken fest aneinandergebunden waren. Nun befestigte sie ein längeres Seil an dieser Fesselung und zwar so, dass es seitlich mehr als einen Meter überstand. Diese überstehenden Enden verknotete sie rechts und links am großen X und zog sie vorher stramm. Nun war ich so fixiert, dass ich mich nicht zur Seite rollen konnte, um den Schlägen auszuweichen. Meine nackten Fußsohlen boten Sonja ein wehrloses Ziel. Ich konnte sie ihr nicht entziehen.
Sonja holte ihren Kochlöffel, ein Ding mit leicht gerundetem Ende so groß wie die Handfläche eines kleinen Kindes. Manche ältere Mädchen hatten auch biegsame Ruten zu diesem Zweck oder kurze dicke Lederriemen. Die Ruten waren echt schlimm, die Lederriemen und Kochlöffel nicht ganz so arg. Trotzdem taten Schläge mit ihnen auch sehr weh, wenn nur fest genug gehauen wurde. Würde Sonja mir eine leichte Lektion erteilen? Oder würde sie mich dermaßen fest schlagen, dass ich anfangen würde zu schreien? Das wusste man in Voraus nie. Auch diese Unsicherheit gehörte zum Gehorsamstraining. Man musste sich dieser Ungewissheit bedingungslos unterwerfen, sie hinnehmen. So oder so konnte man die Härte der Lektion nie beeinflussen. Alles Flehen und Betteln nach Schonung war sinnlos.
Sonja begann mich zu schlagen. Wie erwartet waren die ersten Schläge leicht. Mit leisem Pitsch-Patsch schlug sie abwechselnd auf meine bloßen Sohlen. Es tat nicht weh. Ich zuckte nicht einmal zusammen. Es gab Tage, an denen die Schläge kaum fester wurden. Beinahe gelangweilt schlug man mich auf diese Weise weiter, allerdings oft recht lange, bis ich ein taubes Gefühl in den Fußsohlen verspürte. Sonja machte es anders. Sie steigerte die Festigkeit der Schläge. Beinahe mit jedem Schlag schlug sie härter zu. Der Kochlöffel patschte schon bald so fest auf meine nackten Sohlen, dass ich jedes Mal zusammenzuckte. Ich spannte mich in den Fesseln an in Erwartung des nächsten Schlages. Eine Weile gab mir Sonja die Schläge in schneller Reihenfolge.
Dann machte sie zwischen den einzelnen Schlägen eine kurze Pause von einer Sekunde. Sie legte mehr Kraft in die Schläge. Es begann wehzutun. Ich keuchte und ab und zu stieß ich einen leisen Schrei aus. Sonja hielt mich auf diesem Level ziemlich lange, bis ich mich daran gewöhnt hatte und keinen Mucks mehr von mir gab.
Nun schlug sie härter zu. Immer wieder schrie ich auf. Ich konnte es nicht länger unterdrücken. Ich wand mich in meinen Fesseln in dem vergeblichen Versuch, dem Biss des Kochlöffels zu entkommen. Aber die Fesseln saßen so fest, dass es mir nicht gelang. Ich biss die Zähne zusammen und versuchte, mein Schreien zu unterdrücken. Pitsch-Patsch wurden die Schläge fester.
„Au!“ schrie ich. „Au! Aaah!“ Ich bat Sonja, aufzuhören. Sie hörte nicht auf. Sie schlug fester zu. Sie schlug nun schneller hintereinander und verstärkte mit jedem Schlag die Härte. Ich versuchte standzuhalten, aber nach sieben oder acht Schlägen brach der Damm. Ich fing an zu weinen. Schluchzend wand ich mich in den Fesseln. Sonja schlug noch fester. Laut knallte der Kochlöffel auf meine hilflos dargebotenen Fußsohlen. Ich begann zu schreien. Ich heulte. Ich schrie. Es war unerträglich. Ich konnte es nicht länger aushalten. Unmöglich! Ich flehte Sonja schluchzend um Schonung an. Eine Minute, bitte, nur eine einzige Minute sollte sie mich zu Atem kommen lassen. Oh bitte!
Sonja kannte keine Gnade. Sie führte mich schonungslos über meine Grenzen hinaus. Judith hatte es einmal treffend ausgedrückt: „Sie schlug mich, bis ich völlig außer mir war und ich in einem Universum aus reinem Schmerz landete, in dem es außer der Pein nichts anderes gab und in dem nur ein Gedanken Platz hatte: Es soll bitte-bitte aufhören. An nichts anderes konnte ich mehr denken.“
Genauso erging es mir jetzt. Ich wand mich. Ich heulte. Um Gnade zu betteln brachte ich nicht mehr fertig, ich brauchte die Atemluft zu schreien. Ich brüllte und wand mich aus Leibeskräften. Ich zerrte mit aller Kraft an meinen Fesseln. Sonja verstärkte die Härte der Schläge noch!
„Nein!“ heulte ich. Ich schrie. Ich wand mich unter dem gnadenlosen Biss des Kochlöffels. Es sollte aufhören. Ich konnte nichts anderes denken. Es sollte aufhören. Bitte. Aufhören! Aufhören!
Es hörte nicht auf. Es ging immer weiter. Ich wand mich in Schmerzekstasen, nahm um mich herum nichts mehr wahr, nur puren, reinen Schmerz, der mich dieser Welt vollkommen entrückte. Schmerzexplosionen zuckten fortwährend durch meine Füße. Es hörte nicht auf. Plötzlich wusste ich, dass es nie aufhören würde, dass Sonja mich auf immer und ewig auf die nackten Fußsohlen schlagen würde.
Doch dann hörten die Schläge auf. Einfach so. Mittendrin. Ich konnte nicht glauben, dass es vorbei war und hing angespannt wie ein Flitzebogen in meinen Fesseln. Ich schluchzte laut und unkontrolliert. Da fühlte ich Sonjas streichelnde Hand in meinem Haar: „Es ist zu Ende, Sigrid.“ Schluchzend lag ich da. Ich konnte kaum mit Weinen aufhören. Sie hatte mich so lange geschlagen, dass ich jedes Zeitgefühl verloren hatte. Ich konnte nicht sagen, ob sie mich zwei Minuten oder zwanzig Minuten lang ausgepeitscht hatte. Meine Fußsohlen brannten wie Feuer.
„Wein dich aus, Sigrid“, sagte Sonja freundlich. „Beruhige dich ein wenig.“
Sie ging fort. „Es ist zu Ende, Sigrid“, hatte sie gesagt. Ich konnte mich entspannen. Sie würde nicht zurückkommen und da weitermachen, wo sie aufgehört hatte. Manche von den älteren Mädchen taten das. Petra Volz zum Beispiel. Sie liebte es geradezu, einen in Sicherheit zu wiegen und wenn man glaubte, es sei vorbei, legte sie von vorne los, gnadenloser und härter als zuvor.
Meine Tränen versiegten langsam. Ich lag still da. So konnte ich stundenlang liegen. Egal ob die Fesselung an meinen Händen und Füßen unbequem war. Alles war besser, als der schmerzhafte Kochlöffel. Ich lauschte mit halbem Ohr der Unterhaltung der Mädchen.
Sonja kam zurück. In einem Eimer brachte sie warmes Wasser. Mit einem kleinen Schwamm begann sie meine Fußsohlen zu waschen. „Ganz schön schmutzig“, meinte sie freundlich. „Man sieht deinen Füßen an, dass du den ganzen Tag barfuss läufst. Deine Sohlen sind ganz dunkel. Nun … ich werde sie hell und sauber machen.“ Sie rieb und wusch. Dabei streichelten ihre Finger meine Füße. Ich mochte dieses Gefühl, wenn sie mir die Füße wusch. An den Füßen berührt zu werden war mir sehr angenehm. Schließlich trocknete sie mich ab. Eine Weile hielt sie meine Füße in den Händen, streichelte sie leicht. Dann beugte sie sich hinunter und küsste meine nackten Sohlen.
„Wie weich deine Fußsohlen sind, Sigrid“, sagte sie und küsste mich wieder. „Herrlich weichgeschlagen.“
Früher hatte mich dieser Satz gewundert. Nachdem ich geschlagen worden war, fühlten sich meine Fußsohlen für mich hart wie Bretter an. Aber eines Tages hatte ich auf Geheiß von Schwester Eulalia die kleine Carmen aus der untersten Klasse schlagen müssen und danach wusch ich ihre kleinen, zierlichen Füße wie Sonja es bei mir immer tat. Die ehemals dunkel verfärbten Sohlen Carmens wurden unter dem Schwamm hell. Milchweiß lockten sie meine Lippen. Ich konnte nicht anders. Ich musste Carmens nackte Sohlen küssen. Und tatsächlich, sie fühlten sich wunderbar weich an.
Sonja löste meine Fesseln. Ich richtete mich ächzend auf die Knie auf. „Danke Sonja“, sprach ich. „Danke, dass du mir Gehorsam beibringst.“
Sie lächelte mich an. „Geh nun deine Schularbeiten machen, Sigrid“, sagte sie.
Ich stand auf und verließ das Zimmer. In meinen Fußsohlen spürte ich ein dumpfes Nachglühen des Schmerzes, aber es ließ schnell nach. Das tat es immer. Wenn ich die Tortur ertragen musste, schrie ich wie am Spieß, doch schon zehn Minuten später war alles vergessen und ich war sogar froh, Schläge bekommen zu haben. Das war das Verrückte an Haus Salem. Anfangs, im ersten Jahr, fürchtete man die Schläge, aber mit der Zeit begann man sie auch herbei zu wünschen und wenn man sie erhalten hatte, war man zufrieden damit. Es machte mich verrückt, wenn ich so dachte, doch ich konnte nicht anders. Hätte Sonja mich zurückgerufen, um mich noch einmal auszupeitschen, ich hätte auf der Stelle gehorcht. Nicht nur, weil man mir in drei Jahren absoluten Gehorsam eingebleut hatte, sondern weil ich es auch mochte. In meiner Brust lebten zwei Seelen. Die eine fürchtete die Schläge, die andere liebte sie. Es war ein ewiges Hin und Her.
Wir lernten zusammen Geschichte und halfen anschließend Dunja Tauber beim Rechnen und in Geometrie. Sie war ganz aus dem Häuschen, dass sie mit den Großen mitlaufen durfte. Später gingen wir raus und spielten mit den anderen Mädchen Völkerball. Vorm Abendessen liefen wir noch schnell zum Zaun, der ganz Salem umgab.
Hannah starrte das hohe Gitter aus Schmiedeeisen an. Oben in drei Metern Höhe stachen spitze Stacheln in die Luft.
„Da kommt kein Mensch drüber“, sagte Miriam, die Hannahs Blick bemerkte. „Nach draußen geht es nur durch das große Tor beim Pförtnerhaus und das Tor ist als zweiteilige Schleuse angelegt. Fluchtgedanken kannst du dir also gleich sparen.“
„Was ist mit Ausflügen?“ fragte Hannah. „Sigrid hat mir erzählt, dass wir oft wandern gehen.“
Miriam kicherte. „Versuch mal wegzulaufen, wenn dir die Hände mit Handschellen auf den Rücken gefesselt sind. Das geht nicht.“
„Und wenn wir ausnahmsweise mal in die Stadt gehen“, fügte ich hinzu, „überwachen uns die Nonnen mit Argusaugen. Zudem tragen wir ein Sendeband ums Fußgelenk. Damit können sie uns überall orten. Keine Chance auf Entkommen.“
Dunja Tauber stellte sich mit dem Rücken ans Gitter. Sie reckte die Arme hoch, fasste nach den Stangen, beugte den Kopf zurück und bohrte die Zehen ins Gras: „Ich bin angekettet! Hier bleibe ich stehen, Wind und Wetter ausgesetzt.“
Miriam schüttelte sich: „Besten Dank. Ohne mich. Freiwillig niemals! Die olle Ophelia hat mich im März mal draußen im Regen angekettet und mich hängen lassen, bis ich nass war wie eine Katze. Ich habe vielleicht gebibbert.“
„Lasst uns reingehen“, schlug ich vor. „Wir müssen uns noch waschen.“
Es war Pflicht, sich vorm Abendessen zu waschen. Vor allem die Füße mussten geschrubbt werden. Mit schmutzigen Füßen durfte man nicht in den Esssaal. Also griffen wir flugs zu Bürste und Kernseife und säuberten uns. Im Esssaal wurden Stimmen laut. Als wir eintraten, standen etliche Mädchen um zwei aus der Achten herum. Es waren Ludmilla Sick und Melissa Weiß.
„Du drückst dich schon wieder!“ rief Ludmilla wütend. Sie war ein stabiles rothaariges Mädchen mit robustem Körperbau.
Im Gegensatz zu ihr war Melissa dünn wie ein Spargel und einen Kopf kleiner. „Du spinnst wohl!“ gab sie hitzig zurück. Wenn sich eine drückt, dann bist du es, Zeppelin!“
„Wie nennst du mich?!“ Ludmillas Gesicht verfärbte sich rot.
Genau in dem Moment betrat Schwester Klara den Saal. Augenblicklich herrschte Stille und alle huschten zu ihren Plätzen.
„Lange geht das nicht mehr gut mit den zwei Kampfhähnen“, wisperte Miriam. „Über kurz oder lang fallen sie übereinander her und kloppen sich. Das wird ein interessanter Kampf werden.“
Der Meinung war ich auch: Die stämmige Ludmilla gegen die kleine aber wieselflinke Melissa. Das würde extrem spannend werden. Ich tippte auf Melissa und hätte nichts dagegen gehabt, wenn die großmäulige Ludmilla mal eine drauf bekommen hätte. Doch die Schwestern durften nichts merken. Kämpfchen zwischen den Schülerinnen waren strengstens untersagt. „Ein junges Fräulein schlägt sich nicht“, sagte Schwester Antonia immer. „Junge Damen wälzen sich nicht prügelnd am Boden. Das ist unfein.“
Ich schaute zum Esstisch der Achten. Melissa und Ludmilla saßen sich gegenüber. Ludmilla schnitt Melissa in einem unbeobachteten Moment eine Fratze. Melissa revanchierte sich mit einem festen Schienbeintritt unterm Tisch. Ich verbiss mir ein Grinsen. Die zwei würden bald aufeinander losgehen. Neben dem Tisch der Achten saßen die „Küken“ aus der Fünften und aßen brav zu Abend. Dunja Tauber schaute zu mir her und lächelte schüchtern. Ich lächelte freundlich zurück.
HAU SALEM, Teil 7
Nach dem Abendessen hatten wir noch eine Stunde Handarbeitslehre. Schwester Roberta brachte uns Stricken bei. Ich gab mein Bestes, ließ aber immer mal wieder eine Masche fallen und musste alles wieder auftrennen. Hannah war ein Ass im Stricken. Ihre Finger wirbelten die Stricknadeln so fix durcheinander, dass man ihnen kaum mit den Augen folgen konnte.
„Hat mir Mutti beigebracht, als ich noch kleiner war“, sagte sie, als sie meinen bewundernden Blick auffing.
Mein Blick blieb an Hannahs blaugrauen Augen hängen. Irgendetwas an dem Mädchen zog mich magisch an. Ihre dunklen Haare sahen ein bisschen struppig aus. Einer Eingebung folgend holte ich eine Haarbürste aus einer Schublade. Als ich zu Hannah ging, schaute sie fragend auf. Ich begann schweigend ihr dichtes dunkles Haar zu bürsten. Hannah hielt andächtig still. Ich bürstete weiter. Sie schaute mich mit großen Augen an.
„Was schaust du so?“ fragte ich. Sie sah mich stumm an, mit diesem undefinierbaren Gesichtsausdruck. „Sag doch“, bohrte ich. „Warum guckst du mich so an, Hannah?“
„Das hat noch nie jemand für mich getan“, sagte sie so leise, dass ich sie fast nicht verstand.
„Was denn? Dir das Haar gebürstet?“ fragte ich. „Aber sicher hat dir deine Mutti die Haare gebürstet, als du noch klein warst.“
„Ja“, sagte Hannah. „Aber noch nie hat das eine Schulkameradin für mich gemacht. So etwas habe ich noch nie erlebt.“
Ihre Augen machten mich ganz verrückt. Sie schauten mich so seltsam an, irgendwie flehend und demütig. Mir wurde unter Hannahs Blick ganz anders. Vorsichtig fasste ich nach ihrem Haar und streichelte es. Hannah blickte mich still an. Ich ließ meine Hand tiefer sinken und streichelte ihr Gesicht, ich konnte nicht anders. Hannahs Augen saugten sich an mir fest. Wie die mich anschaute! Davon bekam ich Herzklopfen. Ich fand, dass Hannah total lieb aussah. Rasch schaute ich mich um. Niemand achtete auf uns beide. Ich beugte mich zu Hannah hinunter, umarmte sie und drückte ihr einen flüchtigen Kuss auf die Lippen. Sie erwiderte den Kuss, dann wichen wir scheu auseinander. In der folgenden halben Stunde konnte ich kaum eine einzige richtige Masche stricken. Immerzu schaute ich zu Hannah. Wir blickten uns immer wieder an. Dann lächelten wir uns zu und schauten schnell wieder weg, als ob wir bei etwas Verbotenem erwischt worden wären.
HAUS SALEM, Teil 8
Als die Handarbeitsstunde zu Ende war, mussten wir ins Bett. Am ersten Schultag mussten wir immer früh in die Klappe. Und natürlich rückten die lieben Schwestern mit den Ketten und Handschellen an. Wir wurden nicht immer ans Bett gefesselt. Normal war ein oder zweimal die Woche, aber zur ersten Nacht wurden wir immer am Bett befestigt. Anscheinend hatten die Nonnen Angst, wir würden sonst verloren gehen.
Die Heizung war so weit aufgedreht, dass wir uns nicht zudecken mussten. Die Zudecken und Kopfkissen kamen unter die Betten. Als Schwester Roberta zu mir kam, legte ich mich gehorsam auf mein Bett und hielt ihr die ausgestreckten Arme entgegen. Sie ließ ein Paar stählerne Handschellen um meine Handgelenke schnappen, an deren kurzem Zwischenkettchen eine längere Kette angebracht war. Ich musste mich auf die Seite legen und sie zog die Kette am oberen Bettgestell fest, bis meine Arme vor meinem Gesicht lagen, die Hände ein Stückchen oberhalb meines Kopfes. Dann sperrte sie die Kette am Bettgestell mit einem kleinen Vorhängeschloss fest, damit ich sie nicht heimlich nachts lösen konnte.
Als ob man ein Pferd irgendwo festmacht, dachte ich.
Anschließend zog die Schwester ein weiteres Paar Handschellen aus ihrer Tragetasche, in der es munter klirrte und klimperte, und legte es mir um die Fußgelenke. Schnapp, waren meine Füße gefangen. Mit kaltem, glattem Stahl aneinander gefesselt.
Schwester Roberta wandte sich Hannah zu. Ich hatte mich so hingelegt, dass ich zu ihr ins Nachbarbett schauen konnte. So konnte ich zusehen, wie die Schwester Hannah in Eisen legte. Hannah schaute beklommen, wehrte sich jedoch nicht. Fürs Erste war ihr Trotz gewichen. Oder hielt sie Widerstand bei einer so einfachen Fesselung für unnötig? Nun ja, sie wusste nicht, dass es auch ziemlich ungemütliche Arten gab, ein Mädchen an seinem Bett zu befestigen. Vielleicht würde sie das schon sehr bald kennen lernen. Die Schwestern und die älteren Schülerinnen bewiesen immer wieder aufs Neue eine unerschöpfliche Phantasie, wenn es darum ging, neue Fesselmethoden zu erfinden. Schwester Roberta zog die Kette von Hannahs Handfesseln straff und sperrte sie am oberen Bettgestell fest. Diese metallenen Gestelle oben und unten waren wie geschaffen, um Schnüre und Ketten festzumachen. Bestimmt waren die Betten unter solchen Gesichtspunkten ausgesucht worden. Die Schwester wandte sich Hannahs Füßen zu. Sie packte sie und legte die Handschellen um Hannahs zierliche Fußgelenke. Mit leisem Ratschen schloss sie die Stahlfesseln. Dieses Geräusch hatte für mich schon immer etwas Magisches an sich gehabt.
Mit acht Jahren hatte ich nachts einen Traum. Meine Klasse war unruhig, und wir störten ständig den Unterricht. Schließlich wurde es unserer Lehrerin zu bunt und sie rief die Polizei an. Die rückte prompt an und fesselte uns die Hände mit Handschellen vorm Bauch. Den Rest des Tages mussten wir in Handschellen bleiben. Obwohl es sich mit gefesselten Händen sehr schwer schreiben und malen ließ, schafften wir es, und die ganze Zeit über fühlte ich eine riesige Empörung über das, was man mit uns angestellt hatte. Gleichzeitig fand ich es über die Maßen aufregend, mit Handschellen gefesselt zu sein.
Nach dem Aufwachen spann ich in Gedanken an dem seltsamen Traum weiter und dachte mir in den folgenden Tagen immer neue Arten von Fesselungen aus, die man uns Schülerinnen antat. Mal wurden uns die Hände mit Handschellen hinter dem Rücken zusammengefesselt, dann schnürte man uns mit Seilen an die Stühle, die Arme nach hinten gebogen und die Handgelenke an den beiden Holzlatten festgebunden, die die Rückenstütze trugen. Im Fernsehen kam ein Film, in dem ich sah, wie Galeerensträflingen die Füße vorm Angriff mit eisernen Ketten gefesselt wurden. Flugs dichtete ich das auf mein „geistiges“ Klassenzimmer um. Zusätzlich zu den Handschellen kamen nun auch regelmäßig Fußfesseln.
Ich unterdrückte ein Seufzen. Wenn ich als Achtjährige geahnt hätte, dass ich so etwas wirklich einmal erleben würde! Nur dass die Wirklichkeit eben doch härter war als ausgedachte schöne Geschichten in der Phantasie.
Ich beobachtete Schwester Roberta dabei, wie sie Natascha Maier ans Bett fesselte. Sie befestigte Lederbänder an Nataschas Hand- und Fußgelenken. An den Lederbändern waren schmale, stabile Ketten angebracht. Diese Ketten zog Schwester Roberta nach allen vier Seiten und befestigte sie an den Eckpfosten des Bettes, so dass Natascha aufgespreizt wie ein großes X auf dem Rücken lag. So würde sie die Nacht verbringen.
Als alle Mädchen an ihren Betten festgemacht waren, ging Schwester Roberta zur Tür. Mit einem „Gute Nacht, Mädchen“ löschte sie das Licht und schloss die Tür hinter sich. Wir blieben allein im Dunkeln. Durch die Dachluken schien Mondlicht. Ich sah Hannah im Bett neben mir liegen. Sie sah aus, wie mit flüssigem Silber übergossen. Sie schaute schweigend zu mir herüber. Ich musste daran denken, wie sie mich angesehen hatte, als ich ihr das Haar bürstete. Ich erinnerte mich lebhaft an den Kuss, eine flüchtige Berührung unserer Lippen, so süß und schön. Ich hatte plötzlich das starke Verlangen, Hannah zu umarmen und fest zu drücken. Mit diesem Gedanken im Herzen schlief ich ein.
HAUS SALEM, Teil 9
Als wir am folgenden Morgen in den Esssaal kamen, standen Melissa Weiß und Ludmilla Sick einander gegenüber wie wütende Kampfhähne. Es war abzusehen, dass es bald krachen würde.
„Du dumme Pute! Du hast den Malzkaffee verschüttet!“ keifte Ludmilla. „Das war Absicht!“
„Du hast wohl Pferdeäppel im Hirn“, gab Melissa zurück. „Du hast mich gestoßen. Deswegen wurde was verschüttet.“
„Habe ich nicht!“ fauchte Ludmilla. „Du machst das extra! Um mich zu ärgern! Ich beobachte das schon eine geraume Weile!“
„Was willst DU schon beobachten?“ fragte Melissa hochnäsig. „Du bist doch blind wie eine Nashornkuh. Du siehst nicht, wo du hintappst. Du stolperst sogar über einen Strohhalm, du Blindschleiche.“
„Sei still!“ giftete Ludmilla.
„Und wenn nicht?“ gab Melissa kämpferisch zurück.
„Dann kleb ich dir eine!“
„Mit was denn?“ fragte Melissa aufreizend ruhig. „Mit Pattex oder mit Technicoll-Kleber?“
„Du sollst den Mund halten!“ kreischte Ludmilla. Sie war kurz vorm Explodieren.
Melissa dachte nicht im Traum daran, nachzugeben. Es gefiel ihr sichtlich, die stämmige Ludmilla zu reizen. „Ich brauche meinen Mund nicht zu halten. Der ist festgewachsen. Der kann nicht runterfallen.“
„Halt den Rand!“
Melissa fasste den Rand einer Müslischüssel. „Gut so? Ich halte den Rand, Ludi-Dudi. Ganz fest.“
„Ich kleb dir gleich eine!“
„Du klingst wie eine alte Schallplatte mit einem Knacks. Dauernd wiederholst du dich.“
„Sei still!“ Ludmilla kochte vor Wut.
Melissa musterte sie mit halbgesenkten Lidern. „Ach Ludi-Pudi“, sagte sie mit sanfter Stimme, „warum gehst du nicht hin und küsst den Popo deiner Mutti?“
Das war zu viel für Ludmilla. Mit einem Aufschrei stürzte sie sich auf Melissa. Die wich geschickt aus und ließ Ludmilla über ihr ausgestrecktes Bein stolpern. Ludmilla ging zu Boden und rollte herum wie ein Käselaib. Sie kreischte vor Wut. Ludmilla kam hoch, rasend vor Zorn und griff erneut an. Kreischend gingen die beiden Mädchen aufeinander los.
Wir anderen Mädchen umringten die beiden Kampfhähne und feuerten sie begeistert an. So ein Kämpfchen war doch mal eine schöne Abwechslung. Ludmilla schlug Melissa auf den Rücken, so fest, dass Melissa aufschrie. Sie rächte sich mit einer blitzschnellen Drehung und biss in Ludmillas rechte Wade. Ludmilla quiekte wie ein erschrockenes Ferkel.
„Ja! Ja! Gib es ihr!“ brüllten wir begeistert.
Plötzlich donnerte eine Stimme durch den Saal: „RUHE!“
Erschrocken fuhren wir herum. Schwester Antonia stand an der Saaltür. Ihre Augen loderten vor Zorn. Gemessenen Schrittes kam sie zu uns und baute sich vor Melissa und Ludmilla auf. Die beiden erhoben sich hastig und standen still da, Ludmilla geduckt, Melissa hoch aufgerichtet.
„Zwei junge Fräuleins, die sich prügeln wie schmutzige Gassenjungen!“ sprach die Nonne. Ihre Stimme war leise, fast flüsternd. Wenn Schwester Antonia so sprach, war sie echt sauer. „Wälzt euch am Boden wie balgende Hunde!“ Sie drehte sich einmal langsam im Kreis und nagelte jede einzelne von uns mit den Augen fest: „Und ihr schaut zu und feuert sie auch noch begeistert an! Ihr solltet euch was schämen! Pfui!“
Beschämt schauten wir zu Boden.
Die anderen Nonnen kamen zur Tür herein, angelockt von dem Lärm.
„Unterricht heute HSH!“ blaffte Schwester Antonia. „Nach dem Frühstück geht ihr in die Klassenräume, lasst euch behandeln und kommt alle in die achte Klasse! Redeverbot beim Essen!“
Schweigsam setzten wir uns zum Frühstück. HSH. Na prima. Hatten wir ja lange nicht gehabt. Erst am zweitletzten Schultag! HSH bedeutete ganz einfach: Handschellen Hinten.
Nach dem Frühstück marschierten wir Mädchen in Zweierreihen in unsere Klassenräume. So manche von uns machte ein betretenes Gesicht. Ich konnte mir denken, warum. Die hatten Höschen an. Ich nicht. Ich trug fast nie eins. Unter anderem wegen der berüchtigten Handschellentage. Versuche mal eine, Pipi zu machen, wenn man einen Schlüpfer trägt. Sind die Hände hinterm Rücken zusammengeschlossen, kann man das Höschen zum Pipimachen nicht runterziehen und muss danach im Unterricht nass auf dem Stuhl sitzen. Nein danke!
Schwester Roberte schloss unseren Klassenschrank auf und holte die Handschellen: „Einzelreihe bilden und antreten!“ befahl sie. Folgsam kamen wir der Order nach. Eine nach der anderen mussten wir uns vor Schwester Roberta umdrehen, so dass sie uns die Hände mit den Handschellen hinterm Rücken zusammenschließen konnte. Wir verhielten uns mucksmäuschenstill und so folgsam wie nur möglich. Es war nicht gut, Schwester Roberta zu verärgern, wenn sie der ganzen Klasse Handschellen anlegte. Womöglich fiel ihr ein, das eine oder andere Handschellenpaar ein bisschen zu feste zuzudrücken und das tat weh. Keine wollte das. Solange die Stahlfesseln einigermaßen locker saßen, war es auszuhalten, auch wenn einem im Laufe des Vormittags die Arme lahm wurden, weil sie ständig nach hinten gereckt waren. Künstlerpech! Melissa und Ludmilla würde es wesentlich schlimmer ergehen.
Sobald wir komplett metallisiert waren, trieb uns Schwester Roberta in den Klassenraum der Achten. Dort versammelte sich die ganze Schule. Es wurde ziemlich eng, aber die Nonnen hatten ein System erdacht, wie sie uns alle in einen Raum pferchen konnten. Wichtig war, dass vorne bei der Tafel genug Platz blieb und dass jede alles sah.
Ludmilla und Melissa mussten sich mit den Gesichtern zu uns an die Tafel stellen.
„Wir haben hier zwei sehr unfolgsame Mädchen“, sagte Schwester Antonia laut. „Die haben sich geprügelt. Ihr wisst, was das bedeutet! Wer sich prügelt, der erhält Prügel. Ludmilla Sick, trete vor!“
Ludmilla machte einen Schritt nach vorne. Sie verkrallte die kurzen Zehen ihrer kräftigen Füße im Parkettboden, als wolle sie sich dort festhalten. Sonst ließ sie sich nichts anmerken.
„Du hast die Schlange der Sünde in dein Herz gelassen, Melissa“, sprach die Schwester. „Und die Schlange soll sich über deinen Körper winden, und dein Körper soll sich unter der Schlange winden.“
Ludmilla wurde blass, aber sie gab keinen Mucks von sich. „Ja Schwester Antonia“, sagte sie tapfer.
„Und Melissa Weiß geht an den Pfahl“, ordnete Schwester Antonia an. Sie winkte den Mädchen der obersten Klasse und wollte gerade den Befehl erteilen, sie sollten Ludmilla und Melissa entsprechend behandeln, da fiel ihr ein, dass die gesamte Bande Handschellen trug. Mit einem missmutigen Grunzen wandte sie sich an die Nonnen: „Vorbereiten!“
Wir guckten uns an und grinsten. Manchmal war Schwester Antonia herrlich schusselig. Das gab immer wieder Grund zum Lachen. Hihi!
Zuerst mussten sich Melissa und Roberta ausziehen. Sie legten brav ihre grauen Anstaltskleider ab und falteten sie anständig, bevor sie sie in ein Regal an der Wand sortierten. Dann kamen sie wieder nach vorne. Nackt standen sie vor uns.
Schwester Roberta packte Ludmilla und zog sie zur „Tanzkette“. Die Tanzkette hing vor der Tafel rechts von der Decke. Mit einem Verstellmechanismus an der Wand konnte man ihre Höhe ändern, weil sie oben über zwei eiserne Räder lief. Schwester Eulalia ließ die Kette herab. An ihrem unteren Ende hing ein fünfzehn Zentimeter breites Rundholz. An seinen Enden waren kräftige lederne Schellen angebracht. Ludmillas Handgelenke wurden von vorne in diese offenen Schlaufen gedrückt, die Rückseite der Gelenke gegen das Holz gepresst. Schwester Roberta schloss die Lederschlaufen mit den Schließen, die wie normale Gürtelschließen aussahen. Ludmilla war gefangen. Schwester Eulalia zog die Kette hoch, bis das Mädchen mit über dem Kopf hochgereckten Armen da stand.
Derweil landete Melissa Weiß am Pfahl. Der stand links vor der Tafel und hatte oben einen stabilen Metallhaken. Melissa musste die Hände ausstrecken. Schwester Ophelia legte ihr lederne Fesselmanschetten an, die ihre Handgelenke fest miteinander verbanden. Zwischen den Händen hing eine kurze Kette. Diese zog die Schwester am Pfahl in die Höhe. Melissa musste sich dazu mit dem Bauch gegen den Pfahl stellen. Die Nonne zog die Kette so hoch, dass Melissa ausgestreckt am Pfahl stand und befestigte sie an dem Haken.
Es war mucksmäuschenstill im Raum. Nur gelegentlich vernahm man das leise Klirren von Handschellen. Schwester Jakoba ging zum Klassenschrank und holte die Schlange. Die Schlange war eine lederne Peitsche. Sie hatte einen kurzen Handgriff, an dem ein dickes, glattes Lederband befestigt war. Es gab auch noch „die Geflochtene“, eine ähnliche Peitsche, die jedoch aus drei dünneren Lederschnüren zusammen geflochten war. Ich konnte nicht sagen, welches der beiden Instrumente schlimmer war. Weh taten sie beide. Das fürchterliche an den Peitschen war ihre Unberechenbarkeit. Je nachdem wie die Schwester die Peitsche führte traf sie einen anders. Beugte sie sich beim Schlagen ein wenig vor, klatschte das Leder quer über den Rücken und die Spitze der Peitsche wand sich knallend um den Oberkörper und traf einen noch an der Seite oder gar vorne auf der Brust. Es presste einem die Luft aus der Lunge. Zog die Nonne dagegen beim Schlag den Arm ein wenig zurück, traf einen nur die Peitschenspitze mitten im Rücken, was ein Gefühl erzeugte, als ob dort ein Stück aus dem Leib gerissen wurde. Und man wusste nie, wo die Peitsche zubeißen würde, an den Schultern, weiter unten oder gar am Po oder den Oberschenkeln. Dazu kam, dass ein Mädchen, das an der Tanzkette aufgehängt war, in seiner Not zu „tanzen“ begann. Es wand sich und in dem verzweifelten Versuch, der Peitsche zu entgehen, drehte es sich im Kreis, so dass der gesamte Körper seinen Teil abbekam.
Schwester Antonia nahm die Schlange in Empfang. Wir hörten das Leder bösartig knarren, ein Geräusch, das einen den Atem anhalten ließ. Ludmilla versteifte sich. Die Schwester holte aus und ließ die Schlange quer über Ludmillas Rücken knallen. Der dicke Riemen traf schräg auf und die Spitze der Peitsche wand sich knallend um Ludmillas Oberkörper. Sie schrie auf. Wieder schlug die Schwester zu. Ludmilla bäumte sich auf. Sie versuchte, die Zähne zusammen zu pressen. Vergebens. Kein Mädchen schaffte es, unter der Schlange zu schweigen. Schwester Antonia wusste die Peitsche meisterlich zu führen. Bald wand sich Ludmilla heulend unter dem gnadenlosen Biss des Leders. Bei jedem Schlag zuckte sie zusammen und bäumte sich auf, jeder Treffer entriss ihr einen lauten Schrei. Sie begann an ihrer Haltekette zu tanzen. Sie reckte sich in die Höhe und drehte sich hin und her, um der Schlange zu entgehen, doch es gab kein Entkommen. Sie heulte und schrie. Sie zappelte wild, richtete sich immer wieder auf die Zehen auf und ließ sich in die Fesseln fallen. Die Schlange traf sie überall. Vor allem auf dem Rücken, aber auch auf dem Bauch, den Brüsten und den Oberschenkeln. Schwester Antonia ließ Ludmilla ordentlich tanzen und schreien. Sie gab nicht nach, hörte nicht auf Ludmillas Flehen um Schonung. Sie gab nichts auf eine hastig gestammelte Bitte um Gnade, der gleich der nächste laute Aufschrei folgte. Ludmilla zuckte und wand sich. In ihrer Not machte sie unter sich. Sie konnte es nicht mehr halten. Nun tanzten ihre nackten Füße in einer kleinen Pfütze am Boden.
Schwester Antonia wechselte ständig den Rhythmus ihrer Schläge. Nie behielt sie eine Schlagfolge bei. Manchmal verabreichte sie Ludmilla drei feste Schläge direkt hintereinander, dann wieder ließ sie bis zu zwei Sekunden Zeit zwischen den einzelnen Schlägen. So erreichte sie, dass Ludmilla nie wusste, wie es weitergehen würde.
Melissa schaute vom Pfahl aus zu. Sie hatte Angst. Nicht als Erste dranzukommen, war eine besondere Folter. So konnte man sich noch ausgiebig vor dem fürchten, dass einem bevorstand.
Ich sah zu, wie sich Ludmillas nackter Körper unter der Peitsche wand. Ludmilla war kräftig gebaut. Ihr nackter Leib schien wie geschaffen für die Schlange, die sie endlos tanzen ließ. Das Mädchen wand sich in Schmerzekstasen. Ich wusste, wie Ludmilla sich fühlte. Sie war der Welt entrückt, sie war eingetaucht in ein Universum aus purer Pein, dass sie die Umgebung völlig vergessen ließ. Es zählte nur noch das Hier und Jetzt, und es gab nur einen Gedanken: „Aufhören! Es soll aufhören!“ Das tat es aber nicht. Die Nonnen wussten die Peitsche so einzusetzen, dass man irgendwann jedes Zeitgefühl verlor und es einem so vorkam, als würde es ewig dauern und niemals aufhören. Irgendwann war nicht einmal mehr Verzweiflung übrig sondern nur noch Schmerz, klare pure Pein. Dann kam es vor, dass man sich wunderte, wieso der eigene Körper sich immer noch wand und aufbäumte, wieso der eigene Mund immer noch schrie, wo man es doch hinnehmen musste.
Ludmilla drehte und wand sich. Sie zuckte und bäumte sich auf. Sie zog sich an den Handfesseln in die Höhe. Sie bog ihren Rücken durch. Zum Schluss brachte sie keine Worte mehr hervor. Sie brüllte nur noch aus Leibeskräften, während sie sich unterm Biss der Schlange an der Tanzkette wand.
Es endete so plötzlich, wie es begonnen hatte. Schwester Antonia zog die Schlange zurück und rollte sie seelenruhig zusammen. Ihr Atem ging heftig. Die Auspeitschung hatte sie angestrengt.
Ludmilla sackte in sich zusammen. Hätte die Tanzkette sie nicht gehalten, wäre sie zu Boden gesunken. Sie schluchzte laut. Ihr Körper war mit einem dünnen Schweißfilm überzogen und mit dunkelroten Striemen bedeckt.
„Bedanke dich, Ludmilla“, verlangte Schwester Antonia.
Ludmilla schluchzte dermaßen, dass sie kein Wort hervorbrachte. Sie konnte nur zusammenhangloses Zeug stammeln. Schwester Antonia wartete. Wir hielten den Atem an. Wenn Ludmilla sich nicht schleunigst bedanken würde, drohte ihr eine Fortsetzung der Bestrafung.
„D…danke!“ stammelte das Mädchen unter Tränen. „Danke Schwester Ant…tonia.“
„Du hast bekommen, was du verdient hast“, sprach die Nonne.
„J…ja Schwester Antonia“, erwiderte Ludmilla schluchzend. „Ich habe es verdient. Danke Schwester Antonia.“
HAUS SALEM Teil 10
Schwester Antonia ging zum Schrank und holte etwas heraus. Sie reichte es Schwester Klara: „Wenn sie bitte die Abstrafung vollziehen möchten, Schwester.“ Schwester Klara nahm den blauen Stock, der dem „Roten Heinrich“ aufs Haar glich, mit dem ich tags zuvor Dunja Tauber den Po versohlt hatte. Wie er wohl genannt wurde? Blauer Gustav? Blauer Friedolin?
Melissa kannte seinen Namen, das sah man ihr an. Sie schaute über die Schulter und ihre Augen wurden groß. Vielleicht hatte sie mit etwas Einfacherem gerechnet. Mit dem Kochlöffel zum Beispiel. Der tat nicht sonderlich weh, wenn man den Po damit versohlt bekam. Aber der runde Stecken würde gewaltig zunsen. Melissa atmete tief durch und wandte den Kopf dem Pfahl zu, an dem sie festgebunden war. Es half ja nichts. Sie musste es über sich ergehen lassen. Sie blieb still, aber sie konnte nicht verhindern, dass ihr nackter Körper sich ein wenig anspannte.
Schwester Klara stellte sich so auf, dass wir alle Melissas nackten Po sehen konnte. Probeweise ließ sie den Stock durch die Luft sausen. Ein surrendes Geräusch erklang. Sofort versteifte sich Melissa noch mehr. Wieder schoss der Stock durch die Luft und wieder verkrampfte sich Melissa in ihren Fesseln. Schwester Klara hatte ein Faible für lustige Täuschungsmanöver. Auch beim dritten Mal ließ sie den Stock tüchtig pfeifen, ohne Melissa zu treffen. Aber nur, um den blauen Stock kaum eine halbe Sekunde später auf Melissas Pobacken knallen zu lassen. Melissa schrie auf: „Au!“
Schwester Klara begann sie zu bearbeiten. Sie hatte keine Eile. Die Schläge folgten einander in gemütlichem Sekundentakt, aber die Nonne variierte die Stärke der einzelnen Schläge. Manchmal entlockten sie Melissa nur einen erschrockenen Ausruf, dann wieder brüllte sie vor Schmerz. Ihre Pobacken überzogen sich mit kräftigen roten Striemen. Sie zappelte am Pfahl und versuchte sich in ihren Fesseln zu drehen, um ihren Podex dem bösen Stock zu entziehen, doch Schwester Klara ließ sie nicht auswitschen. Wieder und wieder klatschte der Stock auf Melissas nackten Hintern. Die fing an zu heulen und bettelte um Schonung.
Dies schien Schwester Klara noch zusätzlich anzuspornen. Sie steigerte die Intensität ihrer Stockhiebe und plötzlich auch den Takt. Nun erfolgten die Schläge in kürzester Abfolge. Melissa wand sich schreiend am Pfahl. Sie richtete sich auf die Zehen auf und verdrehte ihren Körper in den Handfesseln. Es sah so aus, als versuche sie in ihrer Not, den Pfahl hinauf zu kriechen. Sie zuckte bei jedem Schlag. Sie bäumte sich schreiend auf. Bäche aus Tränen stürzten aus ihren Augen. „Au! Au! Auu! Bitte aufhören!“ flehte sie schluchzend.
Schwester Klara schlug sie noch fester. Sie schien etwas aus Melissa herausprügeln zu wollen. Melissa brüllte und wand sich. Es dauerte ziemlich lange.
Schließlich hörte Schwester Klara auf. Sie keuchte und wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. Melissa sank schluchzend in den Fesseln zusammen. Sie hatte einen Wahnsinns Abzug erhalten, aber sie hatte sich nicht nass gemacht wie Ludmilla. Ich bewunderte Melissa Weiß dafür. Sie hatte es ausgehalten, ohne sich mit Pipi voll zu machen.
„Danke Schwester Klara“, sagte sie unter Tränen. „Danke.“
„Ihr beiden bleibt die erste Unterrichtsstunde hängen“, befahl Schwester Antonia. „Danach werdet ihr auch in Handschellen gelegt. Ich hoffe, die Strafe hat euer Mütchen gekühlt?“
„Ja Schwester Antonia“, antworteten Ludmilla und Melissa gehorsam. Die Stimmen der Mädchen zitterten.
Unsere Schulleiterin klatschte in die Hände: „Auf, Mädchen! Geht in eure Klassen und lernt brav.“
Wir verließen den Klassenraum der Achten und tappten in unsere eigenen Klassen, innerlich froh, nicht das Selbe erleiden zu müssen wie die beiden Kampfhähne. Doch da war auch stets ein anderes Gefühl in meinem Innersten. Als ich zugesehen hatte, wie sich Ludmilla und Melissa unter Peitsche und Stock wanden, war da der unterschwellige Wunsch gewesen, neben ihnen in Fesseln zu hängen und das Gleiche durchzumachen. Ich kam damit nicht recht klar. Ich hatte Angst vor harten Schlägen, ich fürchtete diese Behandlung und allein der Gedanke daran ließ mich so ängstlich werden, dass ich Herzklopfen bekam und sich mein Magen zu einem kleinen, harten Ball zusammenzog. Gleichzeitig wollte etwas in mir es haben. Wenn ich dann hilflos gefesselt war und es ertragen musste, wollte ich nur loskommen davon. Es sollte aufhören. Ich hätte alles getan, dass es aufhörte. Danach aber fühlte ich eine seltsame kleine Zufriedenheit in mir, die umso größer war, je schrecklicher die Tortur gewesen war, die ich hatte aushalten müssen. Diese widersprüchlichen Gefühle machten mich bisweilen ganz verrückt. Aber sie waren da. Sie existierten. Das konnte ich nicht leugnen. Seit ungefähr einem Jahr wurden sie immer intensiver.
Im Klassenzimmer setzten wir uns brav auf unsere Stühle. Was nicht so einfach war. Wenn man die Hände hinterm Rücken trug, wusste man nie so recht, wie man sich hinhocken sollte. Man konnte sich nicht mit dem Rücken an die Rückenlehne des Stuhls lehnen. Blieb nur, die Arme hinter die Rückenlehne des Stuhls zu hängen. Was wiederum recht unbequem war. So wurde der Unterricht recht geräuschvoll. Allenthalben hörte man ein leises Scharren und die Handschellen klirrten und klimperten, wenn wieder ein Mädchen seine Körperhaltung änderte.
Ich beobachtete Schwester Roberta. Würde sie sauer werden, weil wir so unruhig waren? Das kam vor. Oft gab es dann Pitsch-Patsch. Das zappeligste Mädchen wurde vor die Klasse gerufen. Es musste sich auf den Bauch legen, bekam die Füße mit einem zweiten Paar Handschellen gefesselt und Hände und Füße auf dem Rücken zusammengeschlossen. Dann kamen der Stock oder der Kochlöffel zum Einsatz, und es gab was auf die nackten Fußsohlen. Anschließend musste man den Rest der Stunde am Boden liegen bleiben. In Handschellen war diese Fesselung sehr unbequem. Die Handschellen drückten an den Hand- und Fußgelenken. Das kalte, harte Metall war schon nach kurzer Zeit von einer gemeinen Unerträglichkeit, dass es einen schier in den Wahnsinn trieb.
Doch Schwester Roberta schien keine Lust zu haben, jemanden zu verhauen. Sie hielt ihren Unterricht, als sei nichts dabei, dass die komplette Klasse gefesselt vor ihr saß und raunzte gelegentlich ein besonders zappeliges Mädchen an, es solle endlich still sitzen.
Die große Pause kam und wir durften raus. Hannah schaute mich flehend an: „Sigrid, muss dringend aufs Kloh!“ Sie flüsterte nur.
„Dann geh doch“, antwortete ich.
„Ich kann nicht. Ich bin doch gefesselt“, gab sie zurück. Sie sah ziemlich verzweifelt aus.
Ich verstand: „Du hast einen Schlüpfer an.“
Sie nickte. „Ich will nichts ins Höschen machen“, wisperte sie. „Das ist so eklig. Bitte Sigrid, hilf mir.“
Also tappten wir zusammen zur Toilette. Wir schauten, dass keine zusah. Dann ging es los. Unter Verrenkungen schafften wir es. Ich fasste mit meinen hinten zusammen gefesselten Händen unter Hannahs Schuluniform und bekam ihr Höschen zu fassen. Wir wanden uns wie Schlangenmenschen im Zirkus. Irgendwie kriegten wir das Ding runter. Hannah richtete sich auf und trat aus dem Höschen heraus, das am Boden lag.
„Nimm es mit!“ zischte ich. „Du kannst es nicht einfach liegenlassen. Wenn jemand es sieht, geht es rund. Du weißt doch, dass die Dinger nummeriert sind. Jede Nonne wüsste sofort, dass es dein Höschen ist.“
Hannah hopste von einem Fuß auf den anderen. „Ich muss zuerst“, fiepte sie und lief zu einer der Kabinen. „Oh Herr Jesus Christ“, hörte ich sie drinnen stöhnen. Dann plätscherte es laut und ziemlich lange. Als Hannah wieder auftauchte, wirkte sie sehr erleichtert. „Uff! Das war dringend. Noch eine Minute länger und ich wäre gestorben.“ Sie hockte sich nieder und fummelte mit den hinterm Rücken zusammen geschlossenen Händen herum, bis sie das Höschen zu fassen bekam. „Was mache ich damit?“ fragte sie und stand auf. „Ich kann es doch nicht die ganze Zeit mit mir herum schleppen.“
„Musst du aber“, gab ich zurück und suchte ebenfalls eine Kabine auf. Weil ich unten rum nackt war, konnte ich mich einfach so auf den Toilettensitz niederlassen und Pipi machen.
„Nee“, rief Hannah mir zu. „Ich schleife das Ding nicht den ganzen Vormittag mit mir herum. Stell dir mal vor, die Schwester kontrolliert uns. Wenn sie das sieht, bin ich reif.“
Ich kam aus der Kabine raus. Hannahs Augen blitzten. „Ich lasse mich nicht für so was verkloppen.“
Immer noch die kleine Rebellin, dachte ich. Ich fand, dass Hannah sehr lieb aussah mit den trotzig funkelnden Augen, in denen auch ein bisschen Angst stand.
„Hilf mir“, bat sie. Sie drehte mir den Rücken zu und hielt mir ihr Höschen hin. Dann ließ sie sich auf den Boden nieder und hob die Beine ein wenig an: „Zieh es mir über die Beine, Sigrid!“
Ich kauerte mich vor ihr nieder und versuchte es. Einem Elefanten einen Knoten in den Rüssel zu machen, wäre einfacher gewesen! Wir wanden uns und zappelten blöd herum. Wir mussten dauernd kichern. Aber es klappte. Nach fünf Minuten hatten wir es geschafft. Hannah stand auf.
„Mist. Ich habe es falsch rum an“, verkündete sie. „Das fühlt sich doof an.“
„Egal“, gab ich zurück. „Wir haben keine Zeit mehr, es zu ändern. Gewöhn dich einfach daran, in Zukunft ohne Höschen zu gehen. Dann hast du dieses Problem erst gar nicht.“
Hannah wurde rot. „Ich laufe doch nicht ohne Höschen herum!“
„Warum nicht?“ fragte ich. „Sieht doch keiner. Komm jetzt. Die Stunde fängt gleich an.“ Eilig kehrten wir in unsere Klasse zurück.
Es zeigte sich, dass Hannah gut daran getan hatte, ihr Höschen wieder anzuziehen. Mitten in der Stunde kontrollierte Schwester Roberta uns. Der Reihe nach schaute sie uns unter die Röcke und tatsächlich erwischte sie zwei Mädchen, die ihren Schlüpfer hinterm Rücken in den Händen hielten. Das bedeutete Pitsch-Patsch für Sarah Lauer und Iris Forthofer. Wer unbedingt ein Höschen tragen wollte, der sollte es auch ständig tragen, meinte die Nonne. Selber schuld, wenn man es dann nass machen musste. Bei Agnes Manderscheid und Roswitha Schindler grunzte sie befriedigt. Die hockten mit nassen Höschen da. Ich wäre jede Wette eingegangen, dass die beiden augenblicklich beschlossen, am nächsten Tag auf den Schlüpfer zu verzichten. Sarah und Iris auch. Wobei ich mir bei Iris nicht ganz sicher war. Mir war aufgefallen, dass Iris immer ein Höschen trug, außer sie erhielt den Befehl, unten herum nackt zu gehen. Sie schien es zu mögen, wenn man ihr gegen ihren Willen das Höschen herunter zog, zum Beispiel um ihr den Po zu versohlen.
Kurz bevor der Unterricht zu Ende war, schaute Schwester Roberta Hannah an. „Bist du eigentlich schon enthaart, Mädchen?“
Hannah wurde feuerrot und brachte kein Wort heraus.
„Was ist?“ blaffte die Schwester. „Kannst du nicht antworten? Bist du blöde?“
Hannah schaute sie nur erschrocken an.
Kopfschüttelnd stand Schwester Roberta auf und kam angedampft. Ohne zu fragen fasste sie Hannah unter die Uniform. Hannah zuckte zusammen und versuchte sich dem Griff der Schwester zu entziehen, doch es gelang ihr nicht. Schwester Roberta fasste resolut zu.
„Das ist ja ein regelrechter Urwald“, trompetete unsere feinfühlige Klassenleiterin. „Hast du das gedüngt? So was! In deinem Alter! Das muss heute noch geändert werden! Gleich nach dem Mittagessen. Ich sage den älteren Mädchen Bescheid.“
Ich schaute Hannah an. Sie wirkte verunsichert und sah sehr klein und verletzlich aus, wie sie da auf ihrem Stuhl saß mit zusammen gefesselten Händen. Sie tat mir leid, doch ich konnte ihr nicht helfen. Es würde ihr nicht erspart bleiben.
HAUS SALEM, Teil 11:
Nach dem Mittagessen traten Vanessa Dahl, Nadja Müller, Sonja Röder und Sylvia Fricker vor Hannah. „Mitkommen“, befahl Vanessa knapp.
Hannah schaute erschrocken. Ich nahm ihre Hand: „Ich komme mit, Hannah.“
Die Mädchen aus der obersten Klasse schauten mich an.
„Schwester Roberta hat mir aufgetragen, Hannah alles zu zeigen und immer bei ihr zu sein“, sagte ich. Dabei hielt ich mich hoch aufgerichtet.
„Du denkst wohl, wenn du eine Bestrafung provozierst, ersparst du deiner neuen Freundin die Entblößung ihres Schoßes“, sagte Nadja. „Der Trick zieht nicht, Sigrid Schmidt. Wir sind ja nicht von gestern. Schwester Roberta hat befohlen, dass Hannah enthaart wird, also wird sie enthaart.“ Sie schaute mich streng an: „Du riskierst höchstens, dass du trotzdem ran genommen wirst.“
„Ja Nadja“, sagte ich so demütig wie nur möglich. Innerlich aber dachte ich: Mach doch! Dann macht doch! Fesselt mich, und schlagt mich! Mich kriegt ihr nicht klein! Ich kann alles aushalten! Ich kann so viel aushalten, das glaubt ihr nicht!
Ich erschrak über meine wilde innere Rebellion. Gleichzeitig erfüllten mich diese Gedanken mit tiefer Befriedigung und Stolz. Ich hatte nicht vor Angst gezittert, als Nadja Müller mir drohte. Ich hatte sie offenen Auges angeschaut. Die Zeiten, in denen ich vor einer Behandlung um Schonung flehte, waren vorbei, schon lange. Das würden sie nicht schaffen. Sie konnten mich fesseln und mich dann schlagen, bis ich heulte und schrie. Peitsche, Rute, Gerte, Riemen und Kochlöffel konnten mir Tränen und Schreie abpressen, aber zuvor flehen und betteln kam nicht in Frage. Eher würde ich mir die Zunge abbeißen, als dies zu tun.
Wir gingen ins hintere Zimmer am Ende des Ganges. Unterwegs befahlen die älteren Mädchen jeder, die uns begegnete, uns zu begleiten. Die alte Leier: Sie wollten, dass möglichst viele Mädchen bei Hannahs erstem Mal zuschauten, damit Hannah sich tüchtig schämen konnte. Das machten sie immer so mit den Neuen. Mit der Zeit gewöhnte man sich an die Prozedur und dann kümmerten sich meist nur zwei Mädchen aus der oberen Klasse um einen und es gab kein Publikum mehr. Anders bei Mädchen, die ihre natürliche Scham nie ablegen konnten. Rita Krämer aus der zehnten zum Beispiel wurde noch immer feuerrot, wenn sie sich vor allen Mädchen nackt ausziehen musste und es machte ihr sehr zu schaffen, wenn die ganze Klasse dabei zusah, wenn sie nackt gefesselt war und behandelt wurde. Prompt waren bei der Entblößung ihres Schoßes immer viele Mädchen anwesend.
Im hinteren Zimmer befanden sich außer einem Schrank keine Möbel. Bis auf die Liege in der Mitte des Raumes. Wir nannten es Liege, doch es war ein umgebauter Gynäkologenstuhl mit verlängerter Rückenlehne. Hannah musste sich auf die Liege setzen. Nadja und Sonja packten ihre Beine und spreizten sie. Sie legten Hannahs Schenkel in die Führungen und schnallten sie mit den Lederriemen fest. Dann musste Hannah sich zurücklehnen und die Hände über den Kopf strecken. Am oberen Ende der Rückenlehne befanden sich zwei Lederschlaufen, in die ihre Handgelenke gedrückt wurden. Nadja zog die Schlaufen zu und verschnallte sie. Nun war Hannah fixiert.
Sonja Röder holte eine Sicherheitsnadel aus der Tasche. Sie zog das Vorderteil von Hannahs Kleid hoch und befestigte es mit der Nadel weiter oben, so dass Hannahs Schoß offen vor uns lag. Hannah wurde rot, aber sie sagte kein Wort. Sie setzte ihren Stolz darein, nicht zu betteln. Sie sah wohl ein, dass es sowieso kein Entrinnen gab. Nadja Müller und Vanessa Dahl kippten die Liege nach hinten und arretierten sie, als Hannah auf dem Rücken lag. Sonja setzte sich auf einen Schemel zwischen Hannahs geöffnete Schenkel: „Die Pinzette!“
Sylvia ging zum Schrank und holte sie. Hannah schaute misstrauisch zu.
Sonja nahm die Pinzette in Empfang: „Na dann wollen wir mal. Du hast ein ziemlich dichtes Gebüsch, Hannah Gessner, aber keine Angst, wir werden das schon tüchtig ausholzen.“ Hannahs Gesicht verfärbte sich noch dunkler. Sie schämte sich entsetzlich.
Sonja begann, mit der Pinzette Hannahs Schamhaar zu rupfen. Haar um Haar riss sie aus. Hannah zuckte bisweilen zusammen. Manchmal rutschte ihr ein leises Autsch heraus, oder sie zog zischend Luft durch die Zähne, doch sie gab sich Mühe, keinen Laut von sich zu geben. Sonja arbeitete konzentriert weiter. Die umstehenden Mädchen aus allen Klassen schauten interessiert zu. Bis auf die Jüngsten hatte jede diese Prozedur schon oft durchgemacht und wusste, wie Hannah sich fühlte. Es ziepte dort unten bei jedem Haar, das ausgerupft wurde. Es tat nicht so weh, dass man deswegen geweint hätte, aber es zwickte doch gewaltig. Man wollte, dass es schnell vorüber ging.
Sonja Röder wechselte sich mit den anderen Mädchen ab. Jede hatte ihren eigenen Stil. Die eine arbeitete flink wie eine Nähmaschine und graste die Muschi eines gefesselten Mädchens wie ein Rasenmäher ab, die andere zupfte wahllos an allen Stellen Haare. Oft konnten die älteren Mädchen ihre Finger nicht bei sich behalten. Sie liebten es, an einem herumzuspielen, was der Behandlung einen immensen erotischen Touch verlieh. Angenehme Gefühle und gemeines Pieksen und Ziepen wechselten sich dann ab.
Ich sah zu, wie sie Hannah entblößten. Ihr kleines Fötzchen wurde immer nackter. Hannah spannte ihre Beine an im Bemühen, sie zusammen zu pressen, was natürlich nicht möglich war. Sie war hilflos gefesselt und den älteren Mädchen wehrlos ausgeliefert. Bald standen nur noch vereinzelte Haare rund um Hannahs Muschi. Ich schaute genau hin. Ihre Lippen waren fest und glatt und oben lugte ihr kleines Lustknöpfchen ein Stückchen weit hervor. Es schien frech heraus zu lugen. Ich fand den Anblick höchst begehrenswert. Es sah schön aus. Gerne hätte ich meine Finger dort spielen lassen, um die Nachwirkungen des Ziepens und Zwickens sanft wegzustreicheln. Es tat mir leid, dass Hannah sich so sehr schämte und es nicht einfach hinnehmen konnte. Ich fasste nach ihrem linken Fuß und drückte ihn tröstend, weil ich an ihre Hände nicht rankam. Dort standen zu viele andere Mädchen. Hannah blickte zu mir auf. Ich signalisierte ihr Trost mit den Augen und freute mich, als sie sich ein wenig entspannte. Sanft streichelte ich ihren nackten Fuß: Hab keine Angst, Hannah. Gib dich einfach hin. Nimm es an, dann kannst du es leichter aushalten.
Sie würde von nun an alle paar Wochen die gleiche Behandlung erfahren. Sobald die Härchen nachwuchsen, würde sie auf der Liege im hinteren Zimmer landen. Das ging uns allen so. Für mich war es längst normal. Hannah schaute mich an und ich lächelte ihr zu. Ich fand, dass sie sehr lieb aussah.
Schließlich waren die älteren Mädchen fertig. Sonja Röder entfernte die Sicherheitsnadel, die das Vorderteil von Hannahs Kleid hochgehalten hatte und öffnete die Riemen, die Hannah auf der Liege fixiert hatten: „Fertig. Steh auf.“ Hannah gehorchte. „Dreh dich um!“
Hannah musste sich umdrehen und über die Liege beugen. Vanessa Dahl ging zum Schrank und holte vier Stöcke. Sie hoben Hannahs Kleid hinten hoch und stellten sich in Position. Der Reihe nach ließen sie den Stock auf Hannahs bloße Pobacken sausen. Sie schlugen ziemlich fest, doch Hannah biss die Zähne zusammen und gab keinen Mucks von sich. Jede verabreichte ihr fünf kräftige Hiebe auf den Po, und ihre Hinterbacken überzogen sich mit roten Striemen. Aber Hannah schwieg. Sie zuckte jedes Mal zusammen und presste die Lippen aufeinander, aber sie brachten keinen Laut aus ihr heraus. Vanessa Dahl war die Letzte. Sie trat vor und schlug so fest sie konnte. Hannah riss die Augen auf. Dann schloss sie die Augen. Ihr Gesicht verzerrte sich, aber noch immer kam kein Laut über ihre Lippen. Vanessa hängte noch drei feste Schläge dran. Ihr Stock knallte mit lautem Patschen auf Hannahs nackten Po.
Schließlich hörte Vanessa auf. „Das war alles, Hannah Gerber. Du kannst gehen.“
Hannah richtete sich auf. „Danke Vanessa“, sprach sie mit ruhiger Stimme. Sie sah Vanessa geradeheraus an. Es war ein Starren, ein gegenseitiges Anblicken, und es war Vanessa, deren Augen schließlich Hannahs Blick auswichen. Der Anflug eines Lächelns erschien auf Hannahs Gesicht. Dann nahm sie mich bei der Hand: „Was kommt als nächstes, Sigrid? Ich kenne mich ja gar nicht aus.“
Ich zog sie fort: „Komm mit. Wir haben gleich Handarbeit. Wir lernen Nähen.“ Hand in Hand verließen wir das Zimmer. Hannah trug den Kopf hocherhoben.
„Uff!“ sagte ich draußen auf dem Gang. „Du warst vielleicht tapfer. Keinen Mucks hast du von dir gegeben. Ich habe beim ersten Mal gebrüllt.“
„Ich wollte mir vor denen keine Blöße geben“, sagte Hannah leise. „Wenn sie mich schreien hören wollen, müssen sie es schon härter aus mir heraus prügeln. So leicht bekommen die mich nicht klein!“
„Die jüngeren Mädchen haben dich total bewundert“, sagte ich. Ich lächelte ihr zu. „Na, die Großen auch. Die haben sich bloß bemüht, es nicht zu zeigen. Aber jetzt haben sie dich auf dem Kicker. Sie werden es in ihre Berichtshefte eintragen, dass du bei den Schlägen geschwiegen hast. Vielleicht wirst du gerade deswegen in der nächsten Zeit besonders oft ran genommen.“ Ich drückte ihre Hand: „Es tut mir leid, dass du dich so geschämt hast.“
Sie lächelte schüchtern: „Es war nett, dass du mich getröstet hast.“ Sie kicherte. „Normalerweise drückt man jemandem die Hand, um ihn zu trösten, nicht den Fuß.“
„An eine von deinem Händen kam ich ja nicht ran“, gab ich grinsend zurück. „Da musste eben dein Fuß herhalten.“
„Es fühlte sich gut an“, sagte sie. „Als du das gemacht hast, konnte ich für einen Moment lang vergessen, was das ältere Mädchen gerade bei mir dort unten anstellte.“ Sie fasste sich unters Kleid. „Ein komisches Gefühl. Es ist warm und doch meine ich, zu frieren.“
„Das ist nur in den ersten Minuten so“, sagte ich. „Es vergeht rasch.“
Hand in Hand gingen wir den Flur hinunter. Immer wieder lächelten wir uns an. Ich wusste, dass ich eine Freundin gefunden hatte.
HAUS SALEM, Teil 12
Zum Abendessen gab es Gemüseeintopf, mein Leibgericht. Mochte Haus Salem auch ultrastreng sein, das Essen war hervorragend. Wir saßen artig an den langen schmalen Tischen und aßen manierlich. Mir gegenüber saß Dorothee Fendt. Sie hatte glattes, schulterlanges Haar von umwerfend roter Farbe und hellblaue Augen. Um ihre Nase herum tummelten sich einige vorwitzige Sommersprossen. Dorothees Gesicht war schmal und hellhäutig, ihre Lippen zart geschwungen. Sie schien immer leicht zu lächeln, was sie zusammen mit ihren leicht mandelförmigen Augen sehr sympathisch wirken ließ. Ich schaute zu ihr hinüber, wie sie brav ihren Eintopf löffelte und sich bisweilen mit der Stoffserviette die Lippen tupfte.
Es juckte mich in den Fingern oder besser gesagt in den Zehen, und ich beschloss, Mäuschen zu spielen. Ganz langsam hob ich unterm Tisch mein rechtes Bein und fuhr mit dem nackten Fuß an Dorothees Schenkeln hinauf. Für einen Moment hörte sie auf, zu essen. Dann hatte sie sich gefangen und aß weiter, als sei nichts geschehen. Mein Fuß arbeitete sich langsam an ihren nackten Beinen hoch.
Mäuschen zu spielen war schon bei den jüngeren Mädchen beliebt. Beim Essen mussten wir beide Hände auf dem Tisch lassen und die Mahlzeiten still einnehmen. Aber niemand sah, was unterm Tisch vor sich ging, jedenfalls nicht, wenn man gut aufpasste und keine sich etwas anmerken ließ. Die jüngeren Mädchen stupsten sich unterm Tisch gegenseitig, um ihr Gegenüber zum Zusammenzucken oder Hochhopsen zu provozieren. Wenn man mit der großen Zehe geschickt an den Waden eines Mädchens hoch strich, konnte das so kitzeln, dass die Gekitzelte einen verräterischen Ton von sich gab. Beliebt war auch, das Mäuschen –also den Fuß- ganz nach oben krabbeln zu lassen, wo das Mäuschen dann nachschaute, ob das gegenübersitzende Mädchen ein Höschen trug oder unter der Anstaltsuniform nackt war.
Mehr war nicht. Das hatten wir schon in der Fünften gemacht. Doch im vergangenen Jahr hatte das Spiel in unserer Klasse eine Veränderung erfahren, genau wie unsere Körper. Da war etwas Neues entstanden und wir bekamen plötzlich seltsame Gefühle, wenn uns eine dort unten mit dem nackten Fuß berührte. Es war angenehm, eine ungekannte schwere Süße, die sich dort unten ausbreitete, ein wohliges, prickeliges Gefühl, dem man sich nur zu gerne hingab. Das Spiel bekam eine neue Dimension und hatte von da an etwas Heimliches und Geheimnisvolles. Nun musste man noch besser aufpassen, sich nichts anmerken zu lassen. Die Nonnen durften nichts mitbekommen von dem, was gelegentlich unterm Tisch vorging.
Ich schlüpfte mit dem Fuß unter Dorothees Kleid. Ja, sie war dort unten nackt, als hätte sie aufs Mäuschen gewartet. Ohne sich etwas anmerken zu lassen, öffnete sie ihre Schenkel und gewährte mir bereitwillig Zugang. Ich tastete mit den Zehen sachte zwischen ihren Beinen herum, ließ die Kuppen meiner Zehen sanft streicheln. Dorothees Atem begann schneller zu gehen. Ihr Becken reckte sich meinem Fuß entgegen. Mit der großen Zehe teilte ich die Lippen ihrer Spalte und ließ den Zeh langsam auf und abfahren. Dorothee wurde sofort feucht. Ich hob das Bein ein wenig und erreichte ihre kleine Lustknospe. Ich drückte die Zehe leicht darauf und bewegte sie auf und ab. Dorothee schluckte vernehmlich. Sie starrte angestrengt auf ihren Teller und löffelte ihren Eintopf so konzentriert, als müsse sie eine tickende Zeitbombe entschärfen, die jeden Moment hochgehen konnte. Ich unterdrückte ein Lächeln und machte seelenruhig weiter.
Ich legte meinen Vorfuß auf Dorothees Muschi und drückte rhythmisch, auf und ab, vor und zurück. Dorothee konnte nicht anders, als meinem Rhythmus zu folgen. Sie gab sich allergrößte Mühe, sich nichts anmerken zu lassen. Ich warf einen schnellen Blick in die Runde. Keine am Tisch bekam mit, was sich unter der Tischplatte abspielte. Und die Nonnen saßen weit weg an ihrem eigenen Tisch.
Ich begann wieder mit der großen Zehe an Dorothee herumzuspielen. Ich ließ meine Zehe zart auf ihr kleines Lustknöpfchen drücken und umkreiste es sanft. Dorothee war ganz glitschig geworden. Sie löffelte ihren Eintopf, als sei nichts. Aber ich merkte, dass sie unruhig wurde. Sie konnte kaum noch stillsitzen. Ich machte unbeirrt weiter, ließ sie auf meiner Zehe reiten, streichelte und drückte sanft zwischen ihren Beinen.
Plötzlich versteifte sich Dorothee kurz. Der Löffel mit Eintopf blieb auf halbem Wege zu ihrem Mund kurz in der Luft stehen und sie atmete hastig ein. Dann zwang sie sich zum Weiteressen. Ich spürte die Wärme in ihrem Schoß und glaubte, sanfte Kontraktionen zu ertasten. Dorothee schaute mich kurz an und schloss die Augen. Danke Sigi, ich bin fertig, signalisierte das. Mit einem letzten Streicheln zog ich meinen Fuß zurück und löffelte schweigend weiter.
Plötzlich war ein Fuß unterm Tisch bei mir. Dorothee! Ihr rechter Fuß berührte meinen linken, tapste leicht darauf und kroch dann aufreizend langsam an meinem Bein hoch. Oh weia! Revanche! Darauf war ich nicht gefasst gewesen. Ich tat, als müsse ich niesen und rutschte auf dem Stuhl nach vorne, bis ich auf der Stuhlkante saß. Ich wollte Dorothee soviel Zutritt zu meiner weiblichsten Stelle verschaffen wie nur irgend möglich. Ihre feinen, zartgliedrigen Zehen, die unglaublich beweglich waren, tasteten sich krabbelnd an der Innenseite meines Oberschenkels hoch. Allein diese Bewegung löste einen dermaßen wilden Gefühlssturm in mir aus, dass ich mit Gewalt ein lautes Seufzen unterdrücken musste. Ich blickte in Dorothees Augen und sah den Schalk dort blitzen. Sie kam meiner Öffnung immer näher, doch sie ließ sich Zeit. Zuerst streichelte sie mit den Zehen meine Oberschenkelinnenseite. Sie ließ mich zappeln. Als ihr nackter Fuß endlich bei meiner Möse ankam, war die schon warm und feucht vor Verlangen.
Dorothee hatte sehr schmale Füße. Sie liebte es, ihren Fuß komplett auf meine Muschi zu stellen und mit ihrer schmalen gerundeten Ferse dort auf und abzureiben. Ich empfand himmlische Gefühle. Gleichzeitig musste ich aufpassen, dass mein Körper sich nicht durch Zucken oder sonstige Bewegungen verriet. Dorothee rieb und drückte. Ich konnte kaum still sitzen bleiben. Am liebsten wäre ich auf Dorothees nacktem Fuß geritten, hätte ich mich lüstig daran gerubbelt. Ich wollte mich ihr noch stärker entgegenrecken und spreizte die Schenkel, so weit ich nur konnte.
Dorothee zog den Fuß zurück und begann mit ihren beweglichen Zehen meine Pforte zu erkunden. Anfangs war es ein sanftes Krabbeln, auf und ab und hinein und hinaus. Dann berührte sie mich fester, zerteilte meine Lippen mir ihren Zehen und fuhr die Furche auf und ab. Ihre große Zehe rutschte auf meinem Lustknubbelchen auf und ab, dass ich schier wahnsinnig wurde. Mein Atem ging immer schneller. Ich konnte mich kaum noch aufs Essen konzentrieren. Meine Hand, die den Löffel führte wurde ganz zittrig. Doch niemand am Tisch bemerkte etwas. Keine bekam mit, dass Dorothee mir unterm Tisch höchste Genüsse schenkte.
Sie zog sich zurück und drückte wieder die komplette Fußsohle gegen meine Muschi. Dann begann sie mit der Ferse zu reiben. Langsam erst, dann allmählich schneller werdend. Ich war halb wahnsinnig vor Erregung und fragte mich verzweifelt, wie lange ich noch einen lauten Aufschrei hinauszögern konnte. Ich zerfloss geradezu vor Lust. Dorothee sah es und sie verstärkte ihre Reizungen noch gekonnt. Ich löffelte hastiger, versuchte mich auf den köstlichen Eintopf zu konzentrieren, aber in meinem Schoß spürte ich etwas viel, viel Köstlicheres.
Dann begann es. Von einer Sekunde über die andere kam es über mich. Ich spürte wie meine Füße sich lustvoll verkrampften, wie es in meinen Beinen hochstieg, die sich plötzlich wie aus Gummi anfühlten. Es eilte zu meinem Schoß und ging doch gleichzeitig von dort aus. Noch einmal atmete ich hastig ein. Dann überspülte mich eine Flutwelle und riss mich einfach fort. Welle um Welle lief über meinen Körper hinweg und ließ mich erschauern. Ich musste die Lippen zusammenpressen, um nicht laut zu stöhnen. Es war herrlich, einfach herrlich.
Plötzlich stand Schwester Roberta neben mir und packte unters Tischtuch.
„Hah! Ein Mäuschen!“ rief sie triumphierend und hielt Dorothees Fuß fest. Wir erschraken furchtbar. Alle im Raum hörten auf zu essen und starrten zu uns herüber.
Schwester Roberta ließ Dorothees Fuß los und fasste mir unters Kleid. Sie betastete mich. Ihre Finger wühlten schamlos in mir herum. Am liebsten hätte ich mich ihr entgegengereckt, denn noch immer ritt ich auf Wolken purer Lust dahin, auch wenn ich total erschrocken war.
„Nass!“ rief die Schwester. „Nass wie eine rollige Katze! Sigrid Schmidt, du bist ein schlechtes Mädchen, ein ganz schamloses Ding! Lässt zu, dass deine Nachbarin dir unzüchtige Gefühle bereitet!“
Oh ja, ich war ein schlechtes Mädchen. Ich war unzüchtig. Und wie!
„Wir werden dir das schon austreiben“, sagte Schwester Roberta. „Nach dem Abendessen wirst du öffentlich aufgespreizt. Alle sollen dein sündiges Genital betrachten können, damit sie erfahren, dass von dort die Unkeuschheit herkommt. Du wirst den Riemen zu spüren bekommen.“
Ich schluckte. Der Riemen! Au Backe!